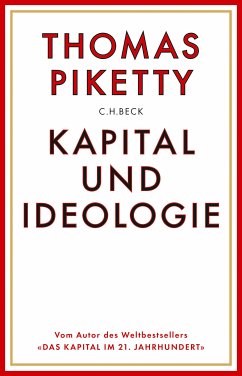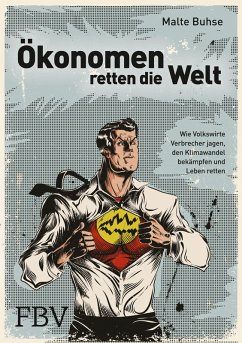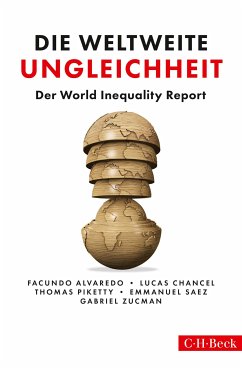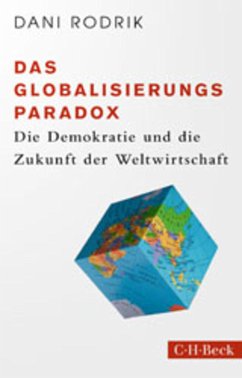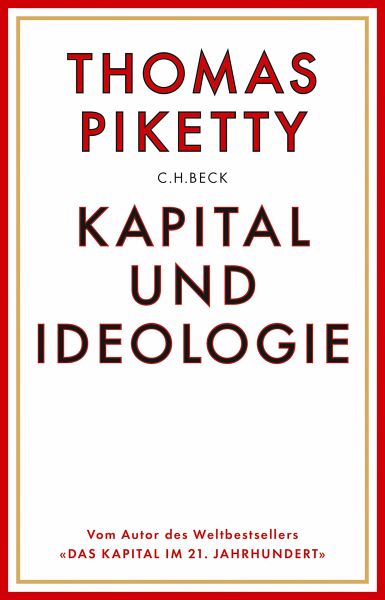
Kapital und Ideologie (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 39,95 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"WER ÜBER KAPITALISMUS REDEN WILL, KOMMT AN THOMAS PIKETTY NICHT VORBEI." HANDELSBLATT Mit dem Weltbestseller "Das Kapital im 21.Jahrhundert" hat Thomas Piketty eines der wichtigsten Bücher unserer Zeit geschrieben. Jetzt legt er mit einem gewaltigen Werk nach: Kapital und Ideologie ist eine so noch niemals geschriebene Globalgeschichte der sozialen Ungleichheit und ihrer Ursachen, eine unnachsichtige Kritik der zeitgenössischen Politik und zugleich der kühne Entwurf eines neuen und gerechteren ökonomischen Systems. Nichts steht geschrieben: Der Kapitalismus ist kein Naturgesetz. Märkte,...
"WER ÜBER KAPITALISMUS REDEN WILL, KOMMT AN THOMAS PIKETTY NICHT VORBEI." HANDELSBLATT Mit dem Weltbestseller "Das Kapital im 21.Jahrhundert" hat Thomas Piketty eines der wichtigsten Bücher unserer Zeit geschrieben. Jetzt legt er mit einem gewaltigen Werk nach: Kapital und Ideologie ist eine so noch niemals geschriebene Globalgeschichte der sozialen Ungleichheit und ihrer Ursachen, eine unnachsichtige Kritik der zeitgenössischen Politik und zugleich der kühne Entwurf eines neuen und gerechteren ökonomischen Systems. Nichts steht geschrieben: Der Kapitalismus ist kein Naturgesetz. Märkte, Profite und Kapital sind von Menschen gemacht. Wie sie funktionieren, hängt von unseren Entscheidungen ab. Das ist der zentrale Gedanke des neuen Buches von Thomas Piketty. Der berühmte Ökonom erforscht darin die Entwicklungen des letzten Jahrtausends, die zu Sklaverei, Leibeigenschaft, Kolonialismus, Kommunismus, Sozialdemokratie und Hyperkapitalismus geführt und das Leben von Milliarden Menschen geformt haben. Seine welthistorische Bestandsaufnahme führt uns weit über Europa und den Westen hinaus bis nach Asien und Afrika und betrachtet die globalen Ungleichheitsregime mit all ihren ganz unterschiedlichen Ursachen und Folgen. Doch diese eindrucksvolle Analyse ist für Thomas Piketty kein Selbstzweck. Er führt uns mit seinen weitreichenden Einsichten und Erkenntnissen hinein in die Krise der Gegenwart. Wenn wir die ökonomischen und politischen Ursachen der Ungleichheit verstanden haben, so Piketty, dann können wir die notwendigen Schritte für eine gerechtere und zukunftsfähige Welt konkret benennen und angehen. Kapital und Ideologie ist das geniale Werk eines der wichtigsten Denker unserer Zeit, eines der Bücher, die unsere Zeit braucht. Es hilft uns nicht nur, die Welt von heute zu verstehen, sondern sie zu verändern.
- Soziale Ungleichheit ist kein Naturgesetz
- Ein unverzichtbares Buch für unsere Zeit
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.