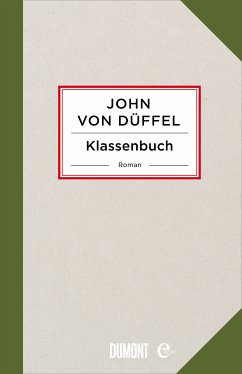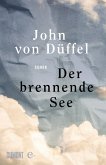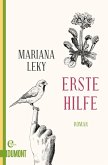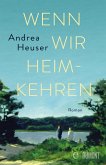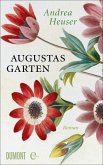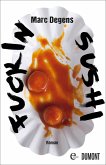Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, SLO, SK ausgeliefert werden.

John von Düffels Porträts von neun Jugendlichen kippen von Kühnheit in Klamauk
Beatrice ist froh, dass sie zur Schule fährt. Und man weiß nicht, ob man ihr das glauben soll, bei allem, was sie hinter sich hat, und allem, was sie vor sich hat an diesem ersten Tag zurück in der Klasse nach ihrem Suizidversuch: die stummen Fragen und die Blicke und die Unbeholfenheit. Aber stumme Fragen und Unbeholfenheit begegnen ihr auch zu Hause. Und Blicke: Von "Scherben in den Augen" ihrer Mutter lässt John von Düffel die Oberstufenschülerin in seinem neuen Roman "Klassenbuch" sprechen, als sie am Vorabend einem Telefonat mit der Lehrerin zuhört und dabei zu spät bemerkt wird. "Sie glauben, sie kennen mich, das glauben sie wirklich. Aber sie verstehen nichts. Sie haben ihre Verständnislosigkeit nur gezähmt."
John von Düffel versteht sich auf Sätze mit Wucht, auf Sätze, die auf der Bühne zu großartigen Momenten des Stillstands führen können, an denen selbst der Herzschlag des Publikums aussetzt: Hier hat jemand Wörter für eine Wahrheit gefunden. Von Düffel ist Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin und Professor für Szenisches Schreiben an der Universität der Künste. Ein besonderes Gespür für Figuren, für Sprechhandlungen, für Sprachwirkung zählt zu den Stärken seiner Prosa, ein Hang zur Theatralik zu ihren Schwachpunkten.
Neun Jugendliche lässt John von Düffel in seinem "Klassenbuch" zu Wort kommen. Sie gehen in dieselbe Klasse, ihre Monologe oder Mails wenden sich an, drehen sich um oder nehmen Bezug auf Frau Höppner, ihre Lehrerin, sie alle sind auf ebenso bestürzende wie berückende Weise mit sich selbst befasst und schreiben in ihren egozentrischen Erzählungen doch die Geschichten der anderen fort. Hat Emily jetzt etwas mit dem Schul-Caterer, dessen Angebot sie öffentlich diffamiert? Ist sie wegen Erschöpfung im Krankenhaus, wie sie selbst behauptet, wegen Ess- oder Persönlichkeitsstörungen oder eines Schwangerschaftsabbruchs? Nina, die im Netz als stets gutgelaunte Sportskanone ihr ganzes Leben vor ihren Fans und Followern ausbreitet, erweist sich in Beas Schilderung als übergewichtige Außenseiterin. Und die sanftmütige, verständige, zuverlässige Annika offenbart in ihren eigenen beiden Entschuldigungsbriefen an die Lehrerin nicht nur einen Hang, unterwegs aufgelesene tote Tiere zu bestatten, den sie mit ihrem kleinen Bruder teilt, sondern auch eigenen Todesdrang: "Bitte entschuldigen Sie, dass ich nicht weiß, wie man Abschiedsbriefe schreibt. Es ist mein erster."
John von Düffel legt seine Figurenzeichnungen als Vexierbilder an, und oft genug hat nicht nur der Kippefekt seine Wirkung, sondern auch jeder einzelne Eindruck seinen Reiz. Der Simpel Henk erweist sich als erstaunlich einfühlsam, zunächst in einer Rechtfertigung als Schulschwänzer, wenn er sich von den eigenen Gedanken immer weiter über das Pausenende hinaus und vom Schulgelände wegtragen lässt: Der Herbst sei "nur ein alter Schlagersänger, der seine abgegriffenen Melodien unters Volk bringt", findet der Junge, "und alle singen und schunkeln innerlich mit und merken gar nicht, dass es immer dasselbe ist, immer dieselben Ohrwürmer der Seele." Später wartet er mit einem Blumenstrauß und einer Reihe von Missverständnissen auf eine Klassenkameradin, die gerade die Aufnahmeprüfung zum Gesangsstudium absolviert, und es wird klar, dass er eine ganze Reihe von Abscheulichkeiten einem weiteren Mitschüler verdankt, der in seinem Namen unter anderem online ein Porno-Video veröffentlicht hat.
Zwei eigene Auftritte im Abstand weniger Wochen gestattet John von Düffel fast allen seinen Helden: Ihre Geschichten schreiben sich fort, ihre Charaktere kippen einmal mehr. Hatte sich zuvor zwischen Selbstbeschreibung und Fremdwahrnehmung eine oft interessante Spannung ergeben, zeigen sie sich in ihrer Entwicklung jetzt allzu oft ins Fratzenhafte verzerrt: Aus Annika ist ein unberechenbarer Todesengel geworden, aus Bea eine Säuferin, die ihrer inneren Ablehnung der eigenen Eltern - "seit ich denken kann, ist da dieser Satz, den ich ihnen sagen will, immer schon: Behaltet eure Liebe für euch" - offene Provokationen folgen lässt. Dass sie ihnen nie verzeihen will, dass die Eltern Bea in ihrem Entsetzen haben gewähren lassen, überzuckert das Grelle diese Szenen dann auch noch mit Moral.
Das mindert die Dringlichkeit der Figuren, ihre Geschichten bekommen etwas Aufgesetztes. Momentaufnahmen wären mehr gewesen. Doch am stärksten leidet das Buch unter einem anderen Aufsatz oder Auswuchs der Handlungen: unter der Überspitzung ins Virtuelle. Die vermeintliche Sportskanone Nina lässt sich unablässig von einer Mini-Drohne umschwirren, die ihr Leben nicht nur aufzeichnet und sendet, sondern die Bilder auch noch gleich so manipuliert, dass unerwünschte Eltern aus den Aufnahmen und unerwünschtes Übergewicht vom Körper der Hauptfigur retuschiert werden. Und der Erpresser ist nicht nur einfach ein digital versierter Klassenkamerad, der die Social-Network-Profile von Henk gekapert hat, sondern ein Super-Hacker, der den Ärmsten über dessen Smartphone regelrecht fernzusteuern vermag.
Den Epilog adressiert dieser Mitschüler in Henks Namen gar an eine künstliche Intelligenz, zu der Frau Höppner seiner Überzeugung nach geworden sein muss, schließlich fehlt sie doch - die anderen Klassenkameraden denken an Schwangerschaft, Krebserkrankung oder Suizid - im zweiten Teil des Buchs. Dessen Lesern indes hätte weder dieser Computer-Klamauk noch der zweite Teil gefehlt.
FRIDTJOF KÜCHEMANN
John von Düffel:
"Klassenbuch". Roman.
DuMont Verlag, Köln 2017. 318 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main