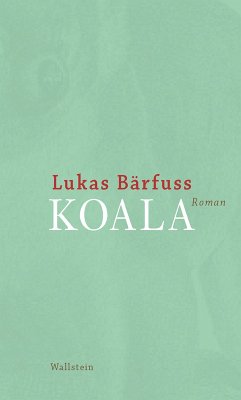Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Wer über das eigene Leben verfügt: Im neuen Roman von Lukas Bärfuss ergründet ein Mann den Tod seines Bruders
Kleists letzten Lebensakt versieht zum Glück kaum noch jemand mit Verdikten, wie sie Sibylle Lewitscharoff 2011 bei der Entgegennahme des in seinem Namen ausgelobten Literaturpreises vorbrachte. Ihrer empörten Distanz aus vermeintlicher Christenpflicht, die fast so anstößig wie ihr jüngstes Wort von assistiert reproduzierten menschlichen "Halbwesen" wirkte, steht aktuell eine hochsensible Debatte über den selbstbestimmten Tod entgegen - nicht zuletzt nach dem bewegenden Blog Wolfgang Herrndorfs. Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss nimmt sich des heiklen Themas Suizid nun in seinem zweiten Roman "Koala" auf souveräne Weise an.
Das Buch berichtet von einem Mann, der wie Bärfuss aus Thun nahe Bern stammt und durch den Selbstmord seines Bruders in eine lange, tiefe Grübelei gerät. Im letzten Satz, der wiederum zum Anfang führt, erklärt dieser Mann nach der Trauerfeier für seinen Bruder: "Ich stieg in den Wagen, fuhr nach Hause, setzte mich an den Schreibtisch und machte mich an die Arbeit." Der gegebene persönliche Anlass des Autors Bärfuss soll hier weiter keine Rolle spielen, da es sich um keinen "biographischen Roman", sondern um ein Stück exemplarischer Reflexionsliteratur handelt: Der Impuls gegen den leichtfertigen Vorwurf feiger, arbeitsscheuer Weltflucht findet sich bereits im "Werther", ebenso wie die Beisetzung des Suizidenten "außerhalb der Kirchhofsmauern". Überhaupt fügt sich die vorgeschlagene nüchterne Haltung, "keine Moral ließ sich schließen", zu dem seit Goethe entwickelten Plädoyer für vorbehaltlose Prüfung jedes einzelnen Falls, aller Umstände und Tatmotive.
Der Erzähler unterhielt keine sehr innige Beziehung zu seinem Bruder - eigentlich einem Halbbruder, von einem anderen Vater. Als dieser sein Leben "abgelegt" hatte, "zurückgegeben wie den Schlüssel einer Wohnung", überfällt den Verbliebenen dennoch ungeahnter Schmerz. Bärfuss zeichnet eindringlich den allmählichen Prozess von der ersten Erschütterung über die nachfolgende Wut angesichts eines unentrinnbaren Eingriffs ins eigene Leben bis zur Ratlosigkeit, den dieser "ordinäre Tod, verbreitet wie Kurzsichtigkeit", hinterlässt. Der Selbstmord, so die poetische Pointe, muss nicht erzählt werden, sondern spricht selbst, "in einer Rede ohne Anfang und ohne Ende". Dieses fast unwillkürliche Selbstgespräch - manchmal laut auf der Toilette bei Freunden, meist aber leise am Schreibtisch - führt zu dem Buch und verdeutlicht dessen ungewöhnliche Anlage.
Dieses Selbstgespräch ergibt sich aus wechselnden Erzählpositionen. Zunächst berichtet ein "Ich" von seinem Kleist-Vortrag in Thun - wo der Dichter einst sein Refugium auf einer Insel in der Aare suchte -, der unwissentlich letzten Begegnung mit dem Bruder, der Todesbotschaft. Davon, wie "er" mit seinen schlechten Augen wiederholt Glastüren durchbrach, vom Unfall mit einem schweren Stahltor, der ihn zum Rollstuhl und stärksten Schmerzmitteln verurteilte, von seiner Hilfsarbeit in einem Obdachlosenheim. Dann kommt "er" selbst in einer längeren erlebten Rede zu Wort, die von der Taufe auf den Namen "Koala" in einem Pfadfinderlager handelt. Dieses "Totem" des Bruders ist schließlich Ausgangspunkt für eine fast hundertseitige historische Binnengeschichte über die britische Kolonisierung Australiens und dessen beliebtes Emblem, den Kuschelbär Koala. Erst auf den letzten Seiten meldet sich der Erzähler vom Beginn mit allgemeinen Überlegungen zum Selbstmord wieder selbst als "Ich" zu Wort.
Was erst zusammenhanglos scheint, entfaltet nach und nach seinen Sinn. Denn die Verbannung britischer Sträflinge auf die Antipoden ist eine Geschichte vom harten Überlebenskampf der Landnehmer, von der Unterdrückung der Aborigines und der Ausrottung vieler Tierarten. Dagegen sind die lebensuntüchtigen, aber niedlichen Koalas friedlich; sie schlafen fast immer und ernähren sich von eigentlich unbekömmlichen Eukalyptusblättern. An deren Gifte gewöhnen sie sich erst allmählich durch die schon einmal verdauten Ausscheidungen ihrer Mütter - ähnlich wie der Bruder durch seinen Unfall an Heroin. In beiden Erzählsträngen geht es also um Allegorien auf das Überleben und die Relativität und Zufälligkeit von Werden und Vergehen. Der lange Exkurs weicht sprachlich von den zuweilen mäandernden Selbstgesprächen des Romananfangs ab und ist historisch und zoologisch sorgfältig recherchiert. Nicht zuletzt das handschriftlich erhaltene und 1981 edierte Tagebuch des Schiffsleutnants Ralph Clark - "Journal kept on the ,Friendship' during a voyage to Botany Bay and Norfolk Island, 1787-1792" - scheint eine wichtige Quelle zu sein.
Am Ende münden die drei Ebenen - das persönliche Selbstgespräch, die Eroberungsgeschichte Australiens und die Sachprosa über Koalas - in die These, der Selbstmord sei überhaupt nicht so unbegreiflich wie zunächst angenommen. Über die hier angebotenen Antworten mag man uneins sein, der intensiven Diskussion sind sie aber allenthalben wert. Vielleicht auch deshalb, weil sie über unerwartete Analogien hergeleitet werden und sich einem besonderen Programm verdanken: Die meisten schweigen über den Suizid, andere verlieren in endlosen Selbstgesprächen darüber den Verstand, Bärfuss reflektiert die Frage hingegen in langen Gleichnissen. Entstanden ist daraus ein ungewöhnliches Buch, das es unbedingt lohnt, weiter überdacht zu werden.
ALEXANDER KOSENINA.
Lukas Bärfuss: "Koala". Roman.
Wallstein Verlag, Göttingen 2014. 184 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main