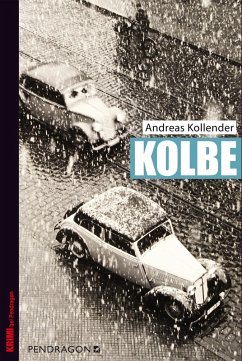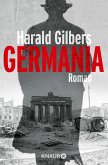Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

In Kürze: Bill Moody, Veit Etzold, Andreas Kollender
Mag schon sein, dass in einem Genre, das von Thrill und Verbrechen lebt, Nostalgie nichts zu suchen hat. Aber wenn man einen Roman liest, der im Prager Frühling spielt, in der Welt des Kalten Krieges, wenn dieser Roman auch noch "Der Spion, der Jazz spielte" (Polar Verlag, 280 S., br., 14,90 [Euro]) heißt, dann stellt sich zumindest beim Leser eine leichte nostalgische Stimmung ein. Bill Moody, der Jazzdrummer und Schriftsteller, hätte sein Buch ja gern auch viel früher veröffentlicht, es sollte bereits 1987 herauskommen, doch dann ging der Verlag pleite, und der Eiserne Vorhang fiel. So vergingen eben mal fünfundzwanzig Jahre, bis sich ein amerikanischer Verlag fand.
Moody hatte 1968 am Prager Jazzfestival teilgenommen und eine Weile in Brünn gelebt. Er ist voller Empathie für die Hoffnungen, die blühten, er kennt das Flair der Freiheit, das die Menschen veränderte. Sein Protagonist ist ein amerikanischer Jazzdrummer, der im August 1968 nach Prag reist. Die CIA erpresst ihn mit einer Lüge, damit er für sie tätig wird. So gerät dieser unpolitische Gene Williams ins Getriebe mehrerer Geheimdienste. Seinen Kontaktmann, der exakte Angaben zum drohenden Einmarsch der Sowjets liefern soll, findet er ermordet auf. Er tut sich mit dessen Enkelin zusammen, um seine Haut zu retten. Er begegnet sogar kurz Alexander Dubcek und ist auf der Straße, als die sowjetischen Panzer durch Prag rollen. Es ist eine altmodische Agentenwelt, mit toten Briefkästen statt verschlüsselter Mails, Beschattung ohne GPS und ohne Mobiltelefone. Weil Moody klar, unprätentiös und mit Gespür für Spannung und Rhythmus schreibt, taucht man gerne noch mal ein in diese analoge Welt, so wie man ab und zu einen alten Le-Carré-Roman wieder liest oder sich einen alten Agentenfilm anschaut.
Veit Etzold, der es mehrfach in die Bestsellerlisten geschafft hat, weiß als Absolvent einer Business School und nebenberuflicher Unternehmensberater, wie die Finanzwelt funktioniert, auch wie man zum Beispiel ein Labyrinth von Firmen konstruiert, in dem schmutziges Geld spurlos verschwindet. Auf seiner Homepage inszeniert er sich als Stratege des Erzählens wie der Kapitalvermehrung mit dem Spruch: "To tell is to sell". "Todesdeal" (Droemer TB, 480 S., br., 14,99 [Euro]) verwertet die ökonomische Expertise in einem gut geölten Plot, der mehrere Erzählstränge integriert und durch rasche Schauplatzwechsel und Cliffhanger angetrieben wird. Fluchtpunkt der Story ist die rohstoffreiche Demokratische Republik Kongo, ein Land nicht weit vom "failed state", in dem chinesische, russische und sogar deutsche Interessen aufeinanderprallen.
Das ist alles interessant und aktuell, wie frisch vom Newsdesk geholt. Die Probleme beginnen, wo Charaktere mit Motiven, Gefühlen und Gedanken ins Spiel kommen müssen, die mehr sind als Vollzugsorgane eines Plots. Da wird es dann schnell sehr dünn. Die beiden deutschen Journalisten gleichen Karikaturen, der eine verfällt einer natürlich schönen, traurigen, dunkeläugigen Chinesin, während er sich zwischen den Fronten verirrt; der kongolesische Warlord springt wie der Schachtelteufel aus der Geisterbahn, der deutsche Staatssekretär und der reiche, verschlagene Russe wirken so, wie der kleine Moritz sich Mann und Milieu vorstellt. Etzold hat auch einen leichten Hang zur schlauen Sentenz. Und sein nassforscher Stil produziert mehr Floskeln, als auf Dauer guttun. In technischer Hinsicht funktioniert die Thriller-Konstruktion durchaus - man muss dabei bloß immer an ein selbstfahrendes Auto voller Crashtest-Dummys denken.
Warum es "Kolbe" (Pendragon, 448 S., br., 16,99 [Euro]), der Roman von Andreas Kollender, auf die Krimi-Bestenliste gebracht hat, ist leicht zu verstehen. Er ist nicht nur spannend, gut recherchiert und gut geschrieben; sein Titelheld ist eine historische Person, die es erlaubt, in einer Geschichte aus Krieg und Nationalsozialismus einen deutschen Helden zu finden. Vielleicht war dieser Fritz Kolbe, ein kleiner Beamter im Auswärtigen Amt, nicht der wichtigste Spion, aber er war einer, der den Amerikanern von 1943 an über die Schweiz hochbrisantes Material lieferte. Schon als Kolbe 1939 aus Südafrika nach Berlin zurück musste, hasste er die Nazis, er war fleißig, unauffällig und effizient, bis er 1943 in der Wilhelmstraße eine Position erreicht hatte, die Zugang zu wichtigen geheimen Dokumenten bot.
Die Liebesgeschichte mit einer Gleichgesinnten und die Schuldgefühle des Vaters, der die Tochter in Deutsch-Südwest zurückließ, hält Kollender in einer sorgfältig austarierten Balance mit den riskanten Aktionen des Spions, den man nicht liebte. In den diplomatischen Dienst durfte Kolbe nach dem Krieg nicht mehr zurück. Mit Helden wie ihm wollte man im verdrängungsseligen Nachkriegsdeutschland keinen Staat machen. Erst Joschka Fischer erinnerte an ihn, als er während seiner Amtszeit einen Saal im Auswärtigen Amt nach Fritz Kolbe benannte. Dem Roman wünscht man eine größere öffentliche Wirkung.
PETER KÖRTE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH