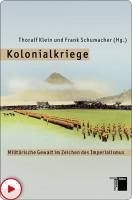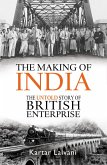Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Koloniale Herrschaft und Gewalt im 19. und 20. Jahrhundert
Die Errichtung kolonialer Herrschaft war eine langwierige, ungleichmäßige Angelegenheit und durch ein komplexes Konkurrenzgeflecht geprägt, in dem nicht selten Europäer gegen Europäer und Einheimische gegen Einheimische standen. Es gab vielerorts Widerstand gegen die kolonialen Eroberer aus Europa, aber ebenso Arrangement und Kooperation. Ein zentraler Aspekt des Kolonialismus war dennoch die Gewalt, in der Regel keineswegs ein Ausdruck der Stärke, sondern der Schwäche der europäischen Kolonialherren. Denn die Europäer stellten selbst in den sogenannten Siedlerkolonien nur eine verschwindend geringe Minderheit dar. Koloniale Herrschaft blieb daher immer prekär. Die Ausübung physischer Gewalt zur Etablierung oder Aufrechterhaltung europäischer Herrschaft war folglich in fast allen Kolonien dauerhaft präsent. Einige Autoren gehen gar so weit, Gewalt als die eigentliche koloniale Herrschaftsform anzusehen. Der koloniale Staat befand sich demnach nahezu überall in einem Zustand permanenter Gewaltsamkeit, ein staatliches Gewaltmonopol fehlte weitgehend.
Die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes formulieren vor diesem Hintergrund den ehrgeizigen Anspruch, eine kulturwissenschaftlich informierte, vergleichende Systematik des Kolonialkrieges zu entwickeln. In diesem Zusammenhang schlagen sie ein Raster aus vier Analyseebenen vor: Bedingungen und Verlauf des Krieges, das konkrete militärische Vorgehen, die mit dem Krieg verknüpften vielfältigen Diskurse und die Erinnerungen an den Krieg. Da sich alle Beiträger an diese Vorgabe halten, ist eine ungewöhnlich kohärente Aufsatzsammlung entstanden. Wie "Kolonialkrieg" trennscharf zu definieren wäre, bleibt jedoch auch nach Lektüre dieses Buches ein wenig unklar. Vor über hundert Jahren jedenfalls bestimmte ein Handbuch des britischen Kriegsministeriums einen kolonialen Krieg als Expedition "disziplinierter Soldaten gegen Wilde und halbzivilisierte Rassen". Gegen diese "Wilden" galten auch Methoden der Kriegführung als legitim, die in Europa längst als moralisch verwerflich und rechtlich unzulässig erachtet wurden. Diese an der kolonialen Frontier praktizierten Formen der Kriegführung fanden im zwanzigsten Jahrhundert jedoch den Weg zurück in die vermeintliche Zivilisation.
Das Spektrum der vorgestellten Beispiele reicht von den Indianerkriegen im Westen der Vereinigten Staaten im neunzehnten Jahrhundert über den sogenannten Burenkrieg - der mit seiner Wendung zum totalen Krieg, zur Mobilisierung aller Ressourcen, zur Einbeziehung der Zivilbevölkerung und zur zentralen Rolle der Guerrillataktik vorauswies auf das zwanzigste Jahrhundert - bis hin zum Dekolonisationskrieg in Algerien. Auch der bisher wenig behandelte Krieg Spaniens in Marokko in den zwanziger Jahren findet Berücksichtigung. Ulrich Mücke zeigt auf, dass der Kolonialkrieg in Nordafrika eine wichtige Rolle für die Brutalisierung des Spanischen Bürgerkriegs spielte. Die Kolonialtruppen, die das Rückgrat des Aufstandes gegen die Republik bildeten, hatten in Marokko gelernt, in ihr bisher unbekanntem Maße Krieg gegen die Zivilbevölkerung zu führen sowie die öffentliche Ordnung durch Terror zu sichern. Die Sieger des Spanischen Bürgerkriegs, schreibt Mücke, "übertrugen nun ihre im Kolonialkrieg gemachten Erfahrungen auf das Heimatland. Spanien wurde zur Kolonie seiner eigenen Armee."
Das kurzlebige deutsche Kolonialreich ist gleich mit zwei Beiträgen vertreten: Thomas Morlang analysiert den Krieg der "Kaiserlichen Schutztruppe" gegen die Hehe im damaligen Deutsch-Ostafrika. Susanne Kuß untersucht den Herero- sowie den Maji-Maji-Krieg, die beide von deutscher Seite mit genozidärem Vernichtungswillen geführt wurden. Und in seinem Beitrag zum "Boxerkrieg" in China betont Thoralf Klein die wichtige Rolle deutscher Militärs in diesem Konflikt. Er hebt überdies die Einzigartigkeit dieses Krieges hervor, in welchem eine aus acht Mächten zusammengesetzte Streitmacht gegen die aufständischen "Boxer" agierte. Am Ende musste sich China von den internationalen Mächten drakonische Straf- und Sühnebedingungen diktieren lassen.
Frank Schumacher greift in seinem materialreichen Aufsatz zum Kolonialkrieg der Vereinigten Staaten auf den Philippinen (1899 bis 1913) laufende Debatten über Washingtons gegenwärtigen "Krieg gegen den Terror" und den Begriff des "Empire Amerika" auf. Einige auf dem amerikanischen Buchmarkt sehr erfolgreiche Autoren feiern "die Geschichte des Kolonialimperiums als weisen Schritt auf dem Weg der USA zur Weltordnungsmacht". Andere verweisen - häufig unter Bezugnahme auf den Philippinen-Krieg - auf die große Bedeutung kleiner und begrenzter Kriege für die amerikanischen Militärtraditionen. Und der bekannte Journalist Robert Kaplan ging vor einigen Jahren so weit, die Erinnerung an den siegreichen amerikanischen Feldzug auf den Philippinen zu einer der "Ten Rules for Managing the World" zu deklarieren. Das Zeitalter der Kolonialkriege scheint noch keineswegs vorbei zu sein.
ANDREAS ECKERT.
Thoralf Klein/Frank Schumacher (Herausgeber): Kolonialkriege. Militärische Gewalt im Zeichen des Imperialismus. Hamburger Edition, Hamburg 2006. 369 S., 35,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH