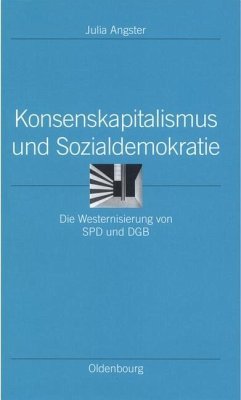Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Amerikanischer Gewerkschaftseinfluß auf SPD und DGB
Julia Angster: Konsenskapitalismus und Sozialdemokratie. Die Westernisierung von SPD und DGB. R. Oldenbourg Verlag, München 2003. 538 Seiten, 49,90 [Euro].
Welchen Einflüssen ist es zu verdanken, daß die Sozialdemokratie 1959 in ihrem Godesberger Programm und der Deutsche Gewerkschaftsbund 1963 in seinem Düsseldorfer Programm endgültig ihren Frieden mit dem Kapitalismus machten? Gab es ein transnationales Netzwerk von Personen und Ideen, das länderübergreifend und langfristig gemeinsame Ziele verfolgte, die schließlich in jenen Programmen ihren Niederschlag fanden? War die "ideelle Westorientierung" von SPD und DGB dem Einfluß einer Seilschaft von Gewerkschaftern und Politikern geschuldet, die im verborgenen wirkte und aus offenen wie verdeckten Quellen über beachtliche materielle und politische Ressourcen verfügte? Das sind Fragen, auf die der Leser Antworten findet, wenn er die vorliegende Studie unbefangen liest.
Julia Angster legt eine solide, fußnotengesättigte Forschungsarbeit zum Einfluß von Funktionären und Ideen der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung AFL-CIO auf das westdeutsche politische Denken vor. Die Arbeit stützt sich in weiten Teilen auf Quellen der amerikanischen Gewerkschaftsbünde, deren reichen Fundus an deutsch-amerikanischen Korrespondenzen sie erstmals umfassend ausgewertet hat. Ihre Ergebnisse erlauben tiefe Einsichten in die europapolitischen Ziele der amerikanischen Seite, dokumentieren aber auch den hohen Grad an Übereinstimmung, der bis Ende der fünfziger Jahre unter den Mitgliedern des Netzwerkes bestand. Da es sich bei diesen um relativ wichtige Gewerkschaftsfunktionäre (Werner Hansen und Ludwig Rosenberg) und zum Teil um einflußreiche SPD-Politiker (Willi Eichler und Fritz Heine) handelte, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, daß das transnationale Netzwerk die Position derjenigen stärkte, die in den fünfziger Jahren die Öffnung der SPD hin zu einer Volkspartei verfolgt haben und die Gewerkschaften aus ihrer programmatischen Fixierung auf Systemveränderung durch Sozialisierung lösen wollten.
So weit, so gut - wären da nicht die theoretischen Stelzen, auf denen die Autorin ungelenk ihr Ziel sucht. Sie erschweren ihr nicht nur unnötig den Weg dorthin. Sie stellen auch das Forschungsziel selbst in Frage. Der Begriff des Konsenskapitalismus ist zur Beschreibung der amerikanischen Arbeitsbeziehungen, die angeblich der deutschen Arbeiterbewegung als Vorbild dienten, zumindest mißverständlich. Im New Deal der dreißiger Jahre sind die amerikanischen Gewerkschaften den europäischen Traditionen der Arbeiterbewegung zwar ein großes Stück entgegengekommen und damit auch dem Konzept der Arbeitsbeziehungen in der "konsensliberalen" Gesellschaftsordnung. In den fünfziger Jahren schlug das Pendel aber schon wieder kräftig zurück. Vor allem stellt sich die Frage, warum ausgerechnet das Athen der Arbeiterbewegung amerikanische Eulen importieren sollte?
Die Ergebnisse der Arbeit verdienten eine subtilere Interpretation. Kaum einer der deutschen Netzwerker war gelernter Sozialdemokrat. Die meisten standen vor dem Krieg am linken Rand der Arbeiterbewegung und teilten nicht die freiheitliche, antirevolutionäre, konsensdemokratische und korporative Haltung der Mehrheit in SPD und ADGB. Es waren vor allem bunte Paradiesvögel im linken Spektrum, die ihr Damaskus im Exil erlebten, sich nach 1945 in der SPD oder in der Einheitsgewerkschaft des DGB wiederfanden und über das Netzwerk in ihrer Entwicklung vom Saulus zum Paulus weiter bestärkt wurden. Auf der Suche nach Vorbildern mußten sie freilich nicht über den Atlantik oder den Ärmelkanal blicken. Wenn jemand über lebendige Traditionen des "Konsenskapitalismus" verfügte, dann war es der Mainstream der deutschen Arbeiterbewegung.
Der zweite Begriff, der die sachlichen Ergebnisse der Arbeit vernebelt, ist die "Westernisierung". Das scheußliche Unwort soll der Abgrenzung vom Konzept der "Amerikanisierung" dienen, das der Autorin auf dem Felde der Arbeiterbewegung wohl doch zu abwegig erschien. Wer nun aber erwartet hätte, daß die Einflüsse der britischen oder skandinavischen Arbeiterbewegungen stärker Beachtung fänden, sieht sich getäuscht. Es geht in der Arbeit nahezu ausschließlich um eine ideengeschichtliche Analyse der Europa- und Deutschland-Politik von AFL-CIO.
Davon abgesehen ergibt der Begriff aber auch in der Sache wenig Sinn. Wo, wenn nicht im "Westen", sollte die deutsche Arbeiterbewegung denn ihre Heimat gehabt haben? Wenn die SPD - wie die Autorin einräumt - seit 1891 innerhalb der europäischen Arbeiterbewegung in ideologischer wie organisatorischer Hinsicht eine hegemoniale Stellung innehatte, stand sie wohl kaum außerhalb der "gemeinwestlichen Werthaltungen". Auch den Antikommunismus mußte die SPD nicht von den Amerikanern lernen. Diese Lektion hatte man seit 1918/19 gründlich verinnerlicht. In der bunten Randzone der Arbeiterbewegung - also außerhalb der SPD - mag dies freilich gelegentlich anders gewesen sein.
Bleibt daher die Einsicht, daß das transatlantische Netzwerk zur Homogenisierung der deutschen Arbeiterbewegung beitrug - spätestens, nachdem sich AFL-CIO 1954 stärker den "rechten" Reformern in der SPD zuwandte, denen man bis dahin "indifferent" bis "ablehnend" gegenübergestanden hatte. Ihr Einfluß sollte aber nicht überschätzt werden. Die Tatsache, daß das Netzwerk in deutschen Archiven und Nachlässen kaum Spuren hinterlassen hat, mag auch taktische Gründe gehabt haben, die es nicht ratsam erscheinen ließen, die "US-Connection" an die große Glocke zu hängen. Sie kann aber auch ganz einfach die Asymmetrie der Bedeutung widerspiegeln, die das Netzwerk diesseits und jenseits des Atlantiks entwickelt hat.
WERNER ABELSHAUSER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH