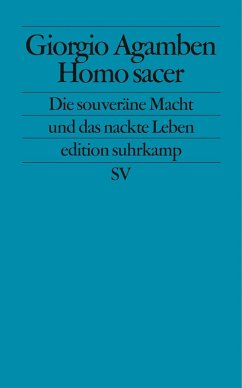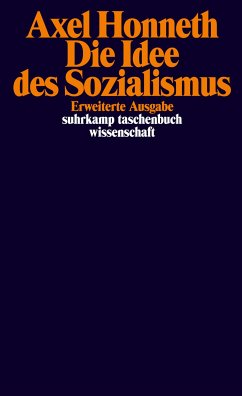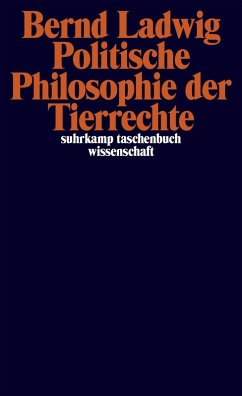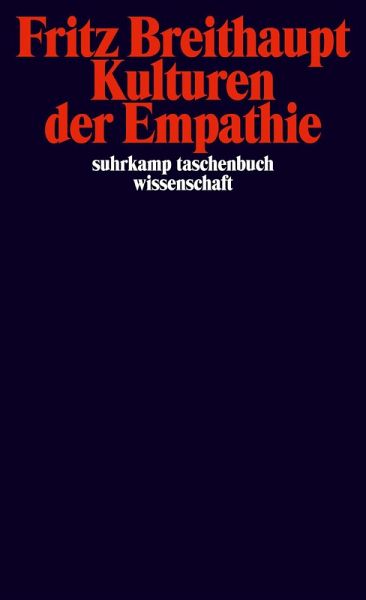
Kulturen der Empathie (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 16,00 €**
15,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wo früher Gesellschaftstheorien auf Kommunikation setzten, erscheint nun zunehmend Empathie oder Einfühlung als Kitt, der die Gemeinschaften zusammenhält. Doch was genau ist Empathie und was leistet sie? Fritz Breithaupt berücksichtigt in seinem Buch die psychologischen und kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte, aber auch die Literatur und Philosophie, die seit Jahrtausenden über Empathie und Mitleid nachgedacht haben, um verschiedene »Kulturen der Empathie« zu unterscheiden. Fluchtpunkt seiner Theorie ist eine Grammatik der Empathie, die menschliche Einfühlu...
Wo früher Gesellschaftstheorien auf Kommunikation setzten, erscheint nun zunehmend Empathie oder Einfühlung als Kitt, der die Gemeinschaften zusammenhält. Doch was genau ist Empathie und was leistet sie? Fritz Breithaupt berücksichtigt in seinem Buch die psychologischen und kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte, aber auch die Literatur und Philosophie, die seit Jahrtausenden über Empathie und Mitleid nachgedacht haben, um verschiedene »Kulturen der Empathie« zu unterscheiden. Fluchtpunkt seiner Theorie ist eine Grammatik der Empathie, die menschliche Einfühlung als einen sozialen Prozeß ausweist, der komplexe Narrationen beinhaltet und eine Idee von Gemeinschaft ins Spiel bringt, die sich mit naturwissenschaftlichen Mitteln allein nicht hinreichend beschreiben läßt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.