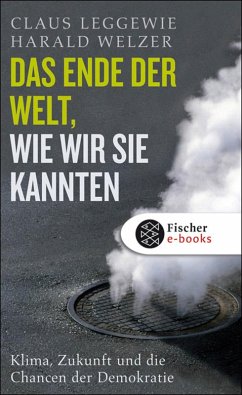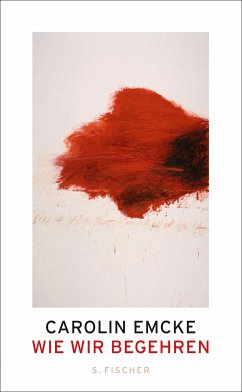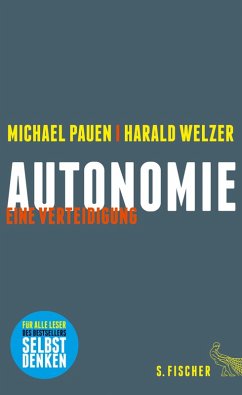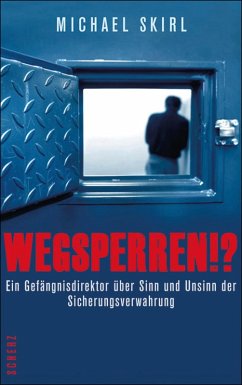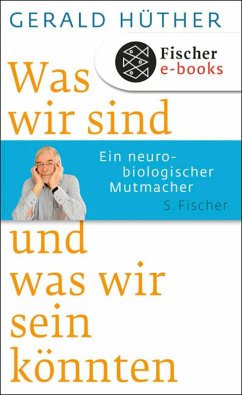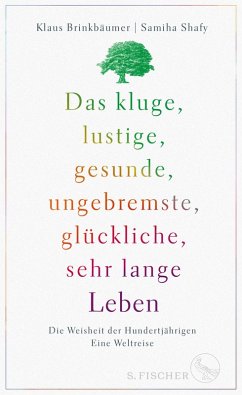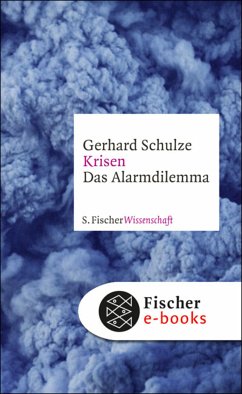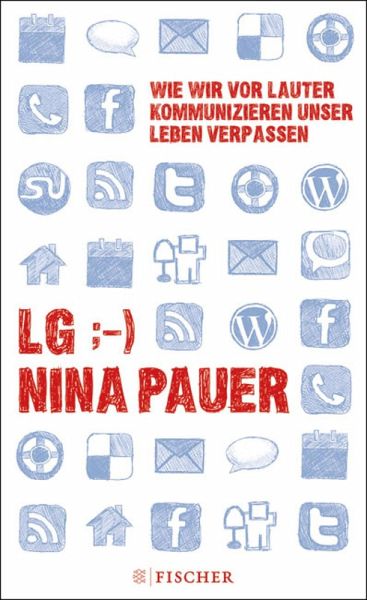
LG;-) Wie wir vor lauter Kommunizieren unser Leben verpassen (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 14,99 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenken

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Noch nie haben wir auf so vielen Kanälen gleichzeitig kommuniziert. Vor allem Menschen zwischen 15 und 35 haben ein zweites, ein virtuelles Ich im Internet, das ihr Leben prägt wie nichts Vergleichbares zuvor. Wer nicht postet, ist nicht! Wer sich nicht einloggt, bleibt außen vor. »Wir müssen dieses Ich im Auge behalten, wir müssen nach ihm schauen, wir müssen erreichbar sein, reagieren können, wenn es etwas von uns will. Wir müssen es füttern, permanent. Das alles tun wir schon lange nicht mehr ganz freiwillig. Wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Wir könnten nicht mehr damit a...
Noch nie haben wir auf so vielen Kanälen gleichzeitig kommuniziert. Vor allem Menschen zwischen 15 und 35 haben ein zweites, ein virtuelles Ich im Internet, das ihr Leben prägt wie nichts Vergleichbares zuvor. Wer nicht postet, ist nicht! Wer sich nicht einloggt, bleibt außen vor. »Wir müssen dieses Ich im Auge behalten, wir müssen nach ihm schauen, wir müssen erreichbar sein, reagieren können, wenn es etwas von uns will. Wir müssen es füttern, permanent. Das alles tun wir schon lange nicht mehr ganz freiwillig. Wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Wir könnten nicht mehr damit aufhören.« Nina Pauer erzählt und erklärt dieses neue Leben. Sie klagt nicht über Facebook & Co., sondern beschreibt die Wirkung exzessiver und besonders virtueller Kommunikation bis tief in den analogen Alltag hinein. Dabei trifft sie nicht nur den Nerv der Betroffenen, sondern bringt die seit Langem einschneidendste Veränderung unserer Gesellschaft auf den Punkt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.