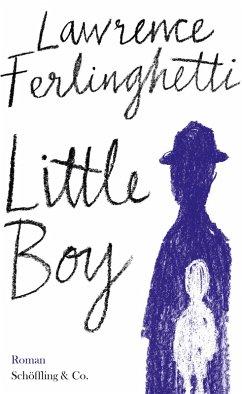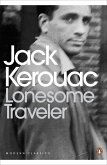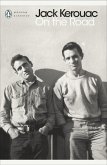Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Lawrence Ferlinghetti, der 99 Jahre alte Beat-Dichter, betrachtet sich selbst als "Little Boy". Sein lyrischer Lebensroman mutiert zur Weltgeschichte.
Von Jan Wiele
Wenn man den Begriff "Memoir" hört, kann einem inzwischen leicht übel werden, so überstrapaziert ist er, Knausgård hin, Eribon oder Ernaux her, und auch in Deutschland sind viele hingerissen von dem Trend, mit dem sich manche langweilige biographische Aufzählung plötzlich als höhere Literatur ausgeben lässt. Da ist es auf den ersten Blick schon einmal erfreulich, dass die als "Roman" verkauften Memoiren des amerikanischen Beat-Dichters Lawrence Ferlinghetti nicht achthundert oder mehrere tausend Seiten füllen, sondern nur knapp zweihundert. Die haben es dafür in sich.
Ferlinghetti, geboren 1919 in New York, beginnt tatsächlich mit einer fast konventionellen Lebenserzählung, allerdings mit keiner angenehmen. "Little Boy war nah am Nichts. Er hatte keine Ahnung, wer er war oder woher er stammte. Er lebte bei Tante Emilie, die er sehr liebte." So geht das ein paar Seiten lang und wird zu einem mit Namen und Familiengeschichte so vollgestopften Dossier bis zum Erwachsenwerden, dass man darin bald den Überblick verliert und auch fast nicht mehr glaubt, hier ein Ferlinghetti-Werk vor sich zu haben. Genau in diesem Moment explodiert der Text.
Es ist eine hübsche Entsprechung zwischen Inhalt und Form: Little Boy, nunmehr zum "Grown Boy" gereift, "fand seine eigene Stimme", heißt es dort, und ab diesem Punkt ist der Rest des Buches verfasst wie eines der Gedichte, die man von Ferlinghetti oder anderen Beat-Poeten wie Allen Ginsberg kennt: als Suada (wenn auch hier wie Prosa gesetzt), als nicht abreißender Bewusstseinsstrom, der alles vermischt von Lebens- bis zur Literatur- und Weltgeschichte und in dem eine Fülle von Bildern, Zitaten, Verweisen treibt oder mitgerissen wird.
Mit dem Beginn der Suada ist auch jegliche Chronologie aufgehoben, es geht nunmehr ohne Punkt und Komma quer durch die Jahrhunderte. Mal kommt man in der Antike, mal in der Moderne heraus, aber ohnehin scheint Ferlinghetti ein Anhänger jenes poetischen Entgrenzungsprogramms zu sein, das Arno Holz 1899 in seinem "Phantasus" entfaltete: "Da so in Hinterindien rum muss ich schon mal irgendwie gelebt haben", hieß es dort, und nun liest man: "ich war mit Noah in der Arche ich war als Rom erbaut wurde in Indien ich war neben dem Esel in der Krippe ich sah in Luna Park wie Laughing Woman bei starkem Regen außerhalb von ihrem Fun House unvermindert lachte".
Die amerikanische Konsumgesellschaft in ihrer Kirmeshaftigkeit ist oft Fluchtpunkt und Zielscheibe des lyrischen Ichs, das in dieser Betrachtungsweise selbst schon lange Tradition hat. "A Coney Island of the Mind" heißt ein berühmter, in Amerika vielgelesener Gedichtband Ferlinghettis von 1958. Da Coney Island bekannt ist für Jahrmarkt, Karussells und Geisterbahnen, kann man die Metapher vielleicht so verstehen, wie wenn ein Italiener von der Welt als grande casino spricht.
Ganz sicher betrachtet Ferlinghetti sie auch heute noch als solche, und es erscheint fast unglaublich, dass der demnächst Hundertjährige immer noch munter dabei ist, ihre neuesten Absurditäten mit dem Furor des Achtundsechzigers, ach was, des Achtundvierzigers in ein Beat-Geheul zu verwandeln, denn bereits 1948 an der Sorbonne sah sich Ferlinghetti in Paris in einer Bewegung. Mit dem Seesack über der Schulter, wie es im Buch heißt, kam er dort in den verschneiten Tuilerien an, und es begann eine Art lyrische Ekstase, die offenbar noch immer anhält: "Rimbaud war ich und Apollinaire war ich und Baudelaire war ich und Villon war ich und ich war alle durchgeknallten streunenden zerlumpten Dichter zusammengerollt in einen Schlaf unter den Brücken dieser Welt."
Was Intertextualität in der Moderne bedeutet, bekommt man vielleicht an keinem Werk so deutlich zu fassen wie an Ferlinghettis: Bald jede zweite Zeile ist bei ihm eine, manchmal auch kalauernde, Wiederaufnahme und Verarbeitung des Bestehenden, das allerdings bei weitem nicht nur französische Schultern hat. Die noch größeren Hausheiligen, die immer wieder genannt werden, sind hier vor allem "Old Walt und Old Ez", nämlich Walt Whitman und Ezra Pound, ferner "Jimmy Joyce und Tea Ass Eliot".
Von des Letzteren Welt-Abgesang "The Waste Land" hat auch "Little Boy" vieles sich einverleibt, das Leben ist für ihn, mit den schönen Worten des Übersetzers Ron Winkler, eine Mischung aus "Wimmernummer" und "Jammerprotokoll". Winkler hat viel zu tun bei der Übertragung der Hauptwortketten Ferlinghettis und seiner traumhaft verdichteten Gedankenbilder, muss dafür sprachschöpferisch werden, um "Hipsterstricher" oder "Blödbürgertum" zu erzeugen.
Dass Ferlinghetti insbesondere die heutige Jugend für blöd hält, daraus macht er kein Hehl. Sein lyrisches Ich, seit jeher ein großer Café-Gänger, sieht mit tiefem Befremden, wie die Fixierung auf elektronische Geräte aus sozialen Wesen asoziale macht. Bei der Beobachtung eines "Jungspundes mit seinem Laptop, beide Ohren von Kopfhörern plombiert", der auf Fragen nicht reagiert, entsteht eine amüsante Phantasie: "Hat er nichts gehört? Ist dieser Körper noch am Leben? Ich bin alarmiert. Ich wähle 911. Nach einer Weile kommt ein Polizeiauto und er wird verhaftet wegen ,Nichtteilnahme an der Menschheit'." So etwas wird Lawrence Ferlinghetti niemals passieren, er nimmt noch sehr aktiv an ihr teil und sähe gern abgewendet, dass "Moloch Mammon gänzlich übernehmen und der Jugendaufstand der Sechziger begraben" wird. "Trauernd schaue ich auf unsere Welt des 21. Jahrhunderts", heißt es an anderer Stelle. Dass er immer noch da ist, um auf seine charakteristische Weise gegen Google, gegen "semiliterate Medien" oder den drohenden "Autogeddon", also unser aller Ersticken an Abgasen, aufzubegehren, ist ein Glück.
Lawrence Ferlinghetti: "Little Boy". Roman.
Aus dem Englischen von Ron Winkler. Schöffling Verlag, Frankfurt am Main 2019. 214 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main