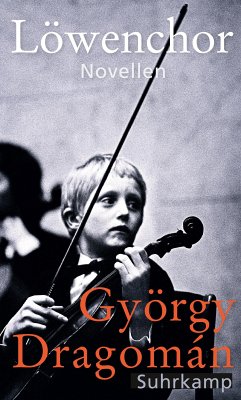Nach der Beerdigung seiner Mutter kehrt Ferenczi nicht in die leere Wohnung zurück, sondern fliegt nach Madrid. Auf dem Hotelbalkon an der Puerta del Sol, während von unten »Tanzmusik, Freudenmusik und Trauermusik« heraufdringt, geht ihm durch den Kopf, wie anders das Leben verlaufen wäre, hätten die kommunistischen Behörden seinen Eltern nicht die Hochzeitsreise nach Spanien verweigert - das Hotel an der Puerta del Sol war schon gebucht. Sein Vater wäre nicht in den Bergen verunglückt, und seine Mutter hätte ihre Gesangskarriere gemacht, statt putzen zu gehen. Wie Stimmen einer Partitur verflechten sich die langen, dichten Sätze und lassen Sequenzen der Vergangenheit und Gegenwart einander durchdringen.
»Dass der Schmerz irgendwann nachließ, davon handelte die Musik«, sagt eine Sängerin, die ihr Leben lang mit Ella Fitzgeralds Cry me a river auftritt und Glück und Qual einer Musikerexistenz bis zum Ende durchstehen muss. Musik als Leidenschaft, Wunschtraum und Fluch, als Katalysator des Übersinnlichen und als Auslöserin von Katastrophen - all diese Motive wandern durch die zwanzig Novellen, aus denen György Dragomán seinen mächtigen Löwenchor zusammengestellt hat.
»Dass der Schmerz irgendwann nachließ, davon handelte die Musik«, sagt eine Sängerin, die ihr Leben lang mit Ella Fitzgeralds Cry me a river auftritt und Glück und Qual einer Musikerexistenz bis zum Ende durchstehen muss. Musik als Leidenschaft, Wunschtraum und Fluch, als Katalysator des Übersinnlichen und als Auslöserin von Katastrophen - all diese Motive wandern durch die zwanzig Novellen, aus denen György Dragomán seinen mächtigen Löwenchor zusammengestellt hat.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

In György Dragománs großem "Löwenchor" verbirgt sich das Grauen hinter der Äolsharfe.
Es gibt viele Kommata in diesem Buch. Nicht ohne Grund. Kommata sind musikalischer als Punkte, und György Dragománs "Löwenchor" ist ein musikalisches Buch. In einem solchen Werk fungieren Punkte wie Taktstriche in einer Partitur: nötig zur Orientierung, hinderlich beim Singen. Für musikalische Prosa eignet sich ein Komma weit besser. Es überwindet strikte Trennungen, lässt frei atmen und ausschwingen, kann Höhepunkte mit einem Vorhalt verzögern helfen, erzeugt immer neue Spannung und findet schließlich eine harmonische Wendung, die den Satz beruhigt. Am Ende eines musikalischen Werkes - ob Novelle oder Streichquartett - gibt es häufig noch ein Dehnungszeichen, selbst wenn es nicht notiert wird: eine Fermate. Sie zeigt an, dass Musik oder musikalische Prosa weiter tönt und im Gedächtnis ihren Nachhall findet.
Auch György Dragománs musikalische Novellensammlung endet mit einer Fermate auf dem letzten Wort des letzten Satzes. Er lautet: "Machen Sie, was Sie wollen." Noch lange klingt er in den Ohren nach, und man fragt sich, ob man selbst machen wird, was man will. Oder vielmehr, ob man je machen konnte, was man wollte. Bei einem ungarischen Schriftsteller aus Siebenbürgen, der noch vor der globalen Wende als Jugendlicher mit seinen Eltern von Rumänien nach Ungarn emigrierte, steht ein harmloser Satz wie dieser nicht grundlos an exponierter Stelle. Es ist eine Aufforderung, die der Autor wohl gerne in seinem Land befolgt hätte, wären solche Sprüche damals dort nicht nahezu tabu gewesen. Wer sie dennoch einmal von sich gab und ihnen auch noch ernsthaft folgte, zahlte dafür mit seiner Existenz.
Erfahrungen eines fremdbestimmten Lebens vibrieren unüberhörbar in diesen neunundzwanzig kurzen Geschichten. Es gehört freilich zu ihren Vorzügen, dass die Erfahrungen des Autors dem Leser nicht im Klagetonfall aufgedrängt werden. Vieles bleibt so latent wie die Klänge der Musik, die in den Erzählungen ein Leitmotiv bildet. Manches wird wie nebenbei erwähnt und überlagert von Beobachtungen, Reminiszenzen an Kindheit und Familie, bis man urplötzlich entdeckt, wie die scheinbar freundliche, in Wirklichkeit lauernde Geschichte ein ursprüngliches Randereignis ins Zentrum des Geschehens rückt.
Zum Beispiel die Sache mit der Fleischsuppe, dem Heiligtum des sonntäglichen Mittagessens der Ungarn; in den Zeiten des real existierenden Sozialismus naturgemäß belastet durch die Mühsal des Fleischbesorgens. Wie viele Episoden wird sie aus der Ich-Perspektive eines Kindes erzählt und beginnt mit einem einzigen, über vier Seiten sich erstreckenden, schier endlos durch Kommata verbundenen Satz; ein Meisterstück der indirekten Erzählung, ein Puzzle aus Informationsbrosamen, die vom Erkenntnistisch der Erwachsenen fallen, aus denen sich das erzählende Mädchen eine komplette Geschichte zusammenreimen muss, die am Ende nicht sie, allenfalls der Leser verstehen wird.
Aber auch er muss rätseln, bis sich mit dem Heranschaffen eines Huhnes für die anständige Suppe das wahre Drama der Familie abzeichnet; dass die Mutter nicht bei einem Unfall gestorben ist, wie man dem Kind erzählte, sondern fast verblutet in der Badewanne gefunden wurde; dass sie nach langer Zeit aus dem Krankenhaus kommen und mit einer kräftigenden Hühnersuppe empfangen werden soll; die Mutter, die Sängerin werden wollte und von Onkel Misi, der eigentlich Arzt war, aber Klavier spielen konnte, in seiner ein paar Stockwerke tiefer gelegenen Wohnung immer begleitet wurde - bis zu jenem Tag, da man sie fand. Tante Olga wird ein Huhn besorgen, bekommt aber nur einen lebenden Hahn, den wiederum nur Onkel Misi schlachten kann, zu dem seit jenem fatalen Ereignis jedoch kein Kontakt mehr besteht. Also geht man mit gemischten Gefühlen zu ihm, und Onkel Misi fragt barsch, was Vater und Tochter von ihm wollen, er sei kein Metzger, sondern Arzt, und Vater sagt, er müsse ohnehin etwas mit ihm besprechen, aber Onkel Misi meint, es gebe nichts zu besprechen, oh doch, sagt der Vater, die Mutter komme nach Hause und sei damals im vierten Monat gewesen, und Onkel Misi sagt, das könne nicht sein, aber er werde nicht mehr hier schlafen, und das Mädchen denkt, nun wird alles gut.
Es ist eine verschachtelte Art des Erzählens, die man raffiniert zu nennen zögert. Dafür ist das, was in den miteinander verschränkten Details und aufgetürmten Szenarien versteckt wird und irgendwann hervorbricht, emotional zu stark, um es mit einem spezifischen Kunstgriff angemessen beschreiben zu können. Dragománs Novellen lassen sich nicht ästhetisch abtun. Sie sind selbst da, wo sie wie das erste Anzeichen von Herbst in einer Sommerszene vorüberhuschen, immer auf die gefährdete menschliche Existenz gerichtet. Etwa, wenn der stilvoll gemixte Gin Tonic und der gepflegte Smalltalk nach dem erfolgreichen Konzert des Syrers Khalid angesichts dessen, was den Künstler bei der Heimkehr erwarten mag, geradezu obszön erscheinen. Die Diskrepanz wirkte kaum monströser, wäre auch nur einmal direkt von Krieg oder Tod die Rede gewesen.
"Löwenchor" ist ein musikalisches Buch durch und durch. Sängerinnen und Geiger, Rockmusikfans und Liebhaber des Neujahrskonzerts aus dem Wiener Musikvereinssaal, fanatische Bastler von perfekten Lautsprechern und geniale Cellisten bevölkern die Szenerie. Aber all die Schicksale und Ereignisse sind untrennbar mit der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit verwoben, aus denen sie der kluge Beobachter György Dragomán ins Schlaglicht seiner Novellen holt: der junge Geiger, gegen dessen Leiden unter drakonischem Drill sich das, was eine Midori in ihrer Autobiographie schilderte, wie ein Ferienlager für angehende Musikgenies ausnimmt; der Rocker, der alle Mauern, die der Sozialismus aufgebaut hat, wenigstens in seiner Phantasie einreißt; die Musikstudentin aus El Salvador, die in der Familie ihres Budapester Freundes mit einer Ablehnung konfrontiert wird, die ihr dunkler Teint allein nicht ausgelöst haben kann.
Der Sohn einer vom politischen System an Ausreise und Karriere gehinderten Sängerin erlebt nun im Westen, wie für Bürgerrechte kämpfende Studenten die Symbole ebenjenes Systems hochhalten, das so viele Rechte beschnitten hat. Die Äolsharfe, deren Klang nicht menschliche Aktion, allein der Wind erzeugt, wird unversehens zur bizarren Chiffre für ein sich wuchernd verselbständigendes Spitzelsystem. Nein, Belcanto gibt es in diesen Novellen nicht, eher "Hells Bells" von AC/DC, noch metallisch schriller, wenn es Jugendliche in der Plattenbausiedlung irgendeiner osteuropäischen Stadt in ihrer nur verballhornt möglichen Version herausbrüllen.
Dragománs Novellen klingen unaufhörlich. Sie erfassen freilich alle Sinne und das Übersinnliche nicht minder. Man spürt es unmittelbar, wenn Hexerei, Aberglaube, Bannfluch in die Handlung eingreifen. Es geschieht nur vereinzelt, aber es erinnert ebenso daran, aus welchem Kulturkreis der Autor stammt, wie die Überbleibsel der alten Donaumonarchie, das Siezen der Eltern etwa oder die vertraute Anrede von älteren Menschen als Onkel und Tante, ohne verwandtschaftliche Verhältnisse damit zu bezeichnen.
Schließlich gibt es die surrealen Geschichten, die bisweilen wirken, als handle es sich um die literarische Deutung eines symbolträchtigen Gemäldes von Chagall oder eine Erinnerung an Kafkas magisch-psychologische Welt. In diese Gattung fügt sich auch das kuriose Bild vom dröhnenden Lachen des Großvaters, das den Ohrensessel mit seinen vier großen Löwenfüßen vibrieren und das gesamte Mobiliar und Geschirr in einem gigantischen "Löwenchor" gleich mit klappern, klirren und knurren lässt, als sollte Maurice Ravels "L'enfant et les sortilèges" neu instrumentiert werden.
Die Antwort auf die Frage, ob eine Sammlung von Erzählungen in einem Zug gelesen werden soll, hängt vom jeweiligen Objekt ab. Bei György Dragománs phantastisch-realistischem Novellenband ist kontinuierliches Lesen strukturell bedingte Voraussetzung. Wie anders könnte ein Chor seine vielstimmige Wirkung entfalten? Aber man muss vorsichtig sein. Man wird in die Polyphonie dieses Löwenchors hineingezogen, vergisst die Umgebung, die Armlehne des Sessels schneidet sich ins Fleisch und hinterlässt bleibende Spuren.
WOLFGANG SANDNER.
György Dragomán: "Löwenchor". Novellen.
Aus dem Ungarischen von Timea Tankó. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 269 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Bei György Dragománs phantastisch- realistischem Novellenband ist kontinuierliches Lesen strukturell bedingte Voraussetzung. Wie anders könnte ein Chor seine vielstimmige Wirkung entfalten? Aber man muss vorsichtig sein. Man wird in die Polyphonie dieses Löwenchors hineingezogen, vergisst die Umgebung, die Armlehne des Sessels schneidet sich ins Fleisch und hinterlässt bleibende Spuren.« Wolfgang Sander Frankfurter Allgemeine Zeitung 20190925