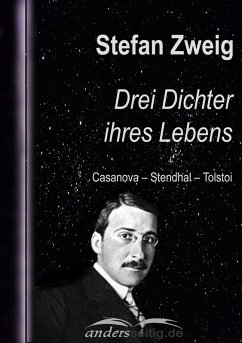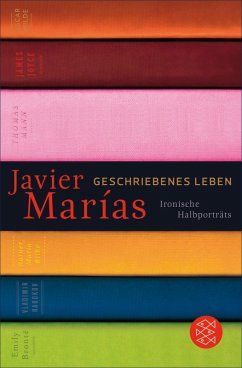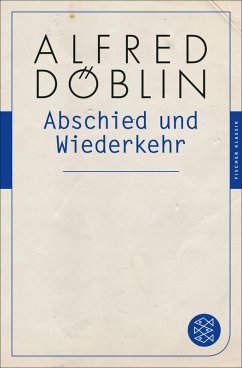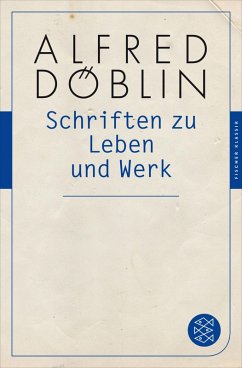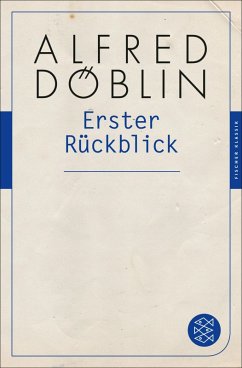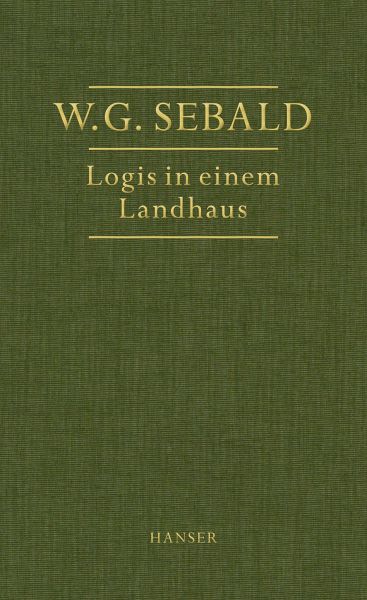
Logis in einem Landhaus (eBook, ePUB)
Über Gottfried Keller, Johann Peter Hebel, Robert Walser und andere
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,90 €**
15,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Buch mit Leinen-Einband)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Eine Landschaft in Büchern. W. G. Sebald folgt in seinen alemannischen Dichterporträts Rousseau auf seiner Flucht bis auf die Petersinsel und er begleitet Robert Walser bei seinen einsamen Spaziergängen durch den Schnee. Ob Keller, Mörike oder Hebel, immer gelingt es W. G. Sebald, die Dichtergestalten, von denen er erzählt, so greifbar vor dem Leser erscheinen zu lassen, als wären sie nur ein wenig entrückte Zeitgenossen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.