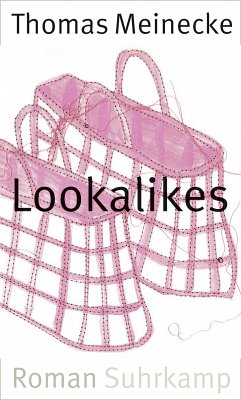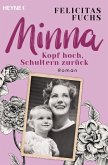Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Doppelt gemoppelt: Thomas Meinecke schreibt mit "Lookalikes" einen Mischpultroman. Beim Samplen gibt es kein Original, nur Variationen des Immeranderen.
Von Daniel Haas
Shakira ist genervt von Lacan. Vor allem von den Tiervergleichen. Frauen und das Animalische, wenn das nicht nach Essentialismus klingt. Justin Timberlake liest Schlegels "Lucinde" und freut sich nebenbei, dass Lacan einst Bataille die Frau ausspannte. Josephine Baker hält sich unterdessen an afroamerikanische Kulturkritik, sie studiert die Schriften von Henry Louis Gates. Über so viel Denkarbeit gerät das Leibliche leicht in Vergessenheit. Zum Glück machen Marlon Brando und Elvis Presley einen Zwischenstopp am Alexanderplatz, um dort Crêpes mit Nutella zu essen. Dazu erörtern sie den Flyer des Techno-Clubs Berghain. Zu welcher Themennacht sollte man gehen? Slime? Oder doch lieber Gummi? Wir sind, ganz klar, in ein Paralleluniversum geraten. Aber wo liegen die Grenzen dieses Textes, in dem auch noch ein gewisser Thomas Meinecke auftaucht, in der Rolle des Kulturstipendiaten, der Brasilien bereist?
Schabernack mit der Realität treiben und mit ihrem Verhältnis zur Fiktion, das ist Vorrecht der Literatur. Und die Textsorten collagieren, bis man nicht mehr weiß, ist das nun ein Roman oder ein Essay oder eine journalistische Zwittergattung - auch das kennt man von avancierter Prosa. Solche Verfahren sind literarhistorisch gesehen eine Erfindung der sechziger und siebziger Jahre; die theoretische Unterfütterung stammt ebenfalls aus dieser Zeit: Strukturalismus, Poststrukturalismus, das Theorietamtam der Postmoderne. Meinecke hat diese Schulen seit jeher als Fundus für seine Erzählarbeit genutzt, seine Bücher kreisen um den Kanon der nachmodernen Spekulation. Was bedeutet Geschlecht? Wie definieren sich Rasse und Herkunft? Und, eine Drehung der Reflexionsschraube weiter: Mit welchen Methoden untersuchen wir solche Wirklichkeiten? Sind unsere Beschreibungsidiome nicht fragwürdig, ideologisch geprägt, Instrumente der Macht?
Hartnäckig kursieren diese Fragen in den Seminaren der Geisteswissenschaften, und dass sie jetzt in diesem Text erneut auftauchen, kann man antiquiert finden oder prätentiös. Man kann den Text, der keinen Plot im streng dramaturgischen Sinne kennt und durch die Genres mäandert (es gibt Interviews, E-Mail-Auszüge, Essay-Exzerpte, wahlweise auf Deutsch oder Englisch), aber auch als Studienbuch wahrnehmen. Dann sind besagte Popstars Fremdenführer durch die Zeichenlandschaften der jüngeren Kulturgeschichte.
Man ist versucht zu sagen: Es sind nur Doubles, die hier in Erscheinung treten; eigentlich sind es prekarisierte Kreative, die sich als Prominentendarsteller ein Zubrot verdienen. Aber "eigentlich" ist ein fragwürdiges Wort im Meinecke-Kosmos; das Eigentliche, das ist auch nur eine Konstruktion, ein Label. Vielleicht kommt mit jener Shakira, die in der Kosmetikabteilung von Kaufhof Galeria jobbt, die Idee einer postkolonialen Pop-Latina viel besser zur Geltung als mit dem Original aus Kolumbien. Vielleicht ist Justin, das Berliner Aushilfsmodel, eine raffiniertere Version des amerikanischen Timberlake. Auf jeden Fall wissen sie um das Artifizielle nicht nur ihrer, sondern unser aller Existenz, insofern sie eingelassen ist in mediale Strukturen.
Studieren wir also: die feinen Verästelungen, die sich zwischen Subkultur und Höhenkammartistik, kanonisierter Geschichte und historischer Kolportage ergeben. Und lassen wir uns (nachdem der Wunsch nach Plot und Handlungsmustern endgültig aufgegeben ist) überraschen: Grace Jones war für Amerika zu androgyn, Yves Saint Laurent aber erkannte in ihr das dekonstruktive role model einer neuen Mode. Lady Gaga lässt sich Lookalike-technisch gesehen leichter erlernen als Britney Spears, weil ihr gesamtes Konzept "aus nichts besteht als aus offensiv ausgestellter Performativität". Audrey Hepburn und Greta Garbo sind zwei Gesichter der Unterhaltungsmoderne, wobei die Garbo quasi platonisch die Idee des Schönen darstellt und Hepburn mehr epiphanisch auf uns kommt. Le Corbusier war verliebt in Josephine Baker, ihr Haus aber durfte Adolf Loos bauen, inklusive Swimmingpool, aus dessen gläserner Architektur sich eine ganze Theorie der Blicklenkung extrapolieren lässt. Überhaupt das räumliche Gestalten: Candomblé, ein religiöser Ritus der Brasilianer (wir erinnern uns: Thomas Meinecke unter- und bewandert dieses Buch als Forschungsreisender auf den Spuren Hubert Fichtes), basiert wie der House-Club architektonisch auf Musik. Rhythmen als tragende Elemente, als Säulen eines sozialen Raums.
Das "Lookalike"-Buch ist also ein Mix, und dass auch das Original nur eine Chiffre darstellt und nie die Sache selbst, diese Überzeugung erscheint als wiederkehrendes Sample in variierenden Tonlagen. "I am a photograph, I am better than the real thing", wird die Sängerin Amanda Lear zitiert.
Ist das nun, gerade in Zeiten glänzender realistischer Erzählwerke, eine bezugs- und rezeptionswürdige Ästhetik? Oder einfach das nächste Theoriedefilee eines Autors, der von Pop als Erklärungsmuster nicht ablassen will? In seiner fragmentarischen Offenheit ist "Lookalikes" jedenfalls ein höchst integrer Text. Er gräbt sich durch die Überschreibungen unseres Alltags mit Images und Labels, um wieder an der Oberfläche aufzutauchen, allerdings mit einem differenzierteren Koordinatensystem. Das ist - wie alle Kritik, die ihr Unbehagen nicht nur auf Inhaltsebene, sondern strukturell, in der Form darstellt - anstrengend, vor allem für den Leser.
Wie hat Meinecke einmal gesagt: "Pop schöpft nicht." Aber er erschöpft. Im Club, im Lauf einer glücklich durchtanzten Nacht. Oder bei der Lektüre, im dahineilenden Groove der Verweise und Bezüge.
Thomas Meinecke: "Lookalikes". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 393 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH