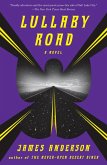Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Verbrechen finden auch dort statt, wo vermeintlich nichts ist: James Anderson tourt in "Lullaby Road" durch die Wüste Utahs.
Naturgemäß muss einer, der über Fernfahrer schreibt, auch einmal als solcher gearbeitet haben. Jedenfalls, wenn er es im Krimigenre zu etwas bringen soll. Besser noch wäre Waffen- oder Drogenhändler, Streifenpolizist, forensischer Pathologe oder wenigstens Gefängniswärter. Straßenglaubwürdigkeit eben. So auch im vorliegenden Fall, der den Amerikaner James Anderson als Trucker, Holzfäller und Fischer ausweist - neben einer langen Berufstätigkeit im Verlagsgewerbe.
James Anderson ist jenseits der sechzig, er kam spät zum Schreiben und hat sich mit zwei Romanen Achtung erworben. Sein Debüt "Desert Moon" (F.A.Z. vom 4. Februar 2019) kam auch bei der deutschen Kritik gut an, nun liegt der zweite Band vor, "Lullaby Road", der erneut den halb indianischen, halb jüdischen Lkw-Fahrer Ben Jones in den Mittelpunkt des Geschehens stellt. Ben ist als Waise bei Mormonen aufgewachsen. Mit seinem Truck fährt er durch die Hochwüste der Four Corners, einem Plateau, in dem die Bundesstaaten Utah, Colorado, New Mexico und Arizona (im Uhrzeigersinn) aufeinandertreffen. Ein Gebiet, so groß wie Deutschland.
Die State Route 117, die der Anfangsdreißiger befährt, gibt es, aber sie ist im wirklichen Leben nicht hundert Meilen lang, und auch die Käffer wie Rockmuse sind teilweise fiktiv. "Wüstenratten und Exzentriker" hausen hier, Ben Jones beliefert sie mit Waren des täglichen Bedarfs und anderen Bestellungen. Etwa den alten, bärenstarken Walt Butterfield, seit 1953 Inhaber des "Well Known Desert Diner", das seit den siebziger Jahren geschlossen ist. Walt hat die Männer, die seine Frau vergewaltigt haben, getötet und aus seinen Erinnerungen ein Museum gemacht. Nun ist die Kneipe als "The Never-Open Desert Diner" bekannt, und als solche gab sie Andersons Debüt den Originaltitel.
Der Latino Pedro vom Stop'n'Gone Truck Stop am Stadtrand der real existierenden Gemeinde Price, den Ben nur vom Reifenwechseln kennt, stellt seinen Sohn Juan und einen Wachhund eines kalten Wintermorgens an die Straße mit einem Zettel: Ben möge ihn einen Tag mitnehmen und keinem was davon erzählen, er vertraue nur ihm. Ähnlich Ginny, die achtzehnjährige alleinerziehende Tochter einer früheren Geliebten Bens, die sich aus der Obdachlosigkeit aufs College hinaufarbeiten will. Sie bewohnt die andere Hälfte von Bens Doppelhaus. Am nämlichen Morgen drückt sie ihrem Vermieter ihr Baby Annabelle in die Hand: Ben möge sie mit auf Tour nehmen, sie habe keinen Babysitter, aber zwei Prüfungen zu bestehen.
Und so zuckelt Ben los, "ins Herz von Nichts", mit einem Baby, Windeln, Milch, einem stummen Sechsjährigen und einem scharfen Hund im Fahrerhaus. Es gab schon rasantere Einstiege in Kriminalromane. Auf den nächsten zweihundert Seiten sitzt der Leser im Fahrerhaus, erlebt wilde Überholmanöver, Beinahe-Unfälle, den besonderen Reiz der Wüstenfarben, die Schrecken des Eises und der Finsternis nach Sonnenuntergang und jede Menge äußerst skurrile Kundschaft. Dazu Bürgerkunde, Lokalgeschichte, Klatsch. Nichts deutet auf Verbrechen oder gar eine Ermittlung hin. Nur Ben macht sich eben so seine Gedanken - über diese und jenen.
Ab und zu tauchen Cops auf, kassieren Schweigen. Etwa auf die Frage, wer John, den Gründer der Ersten Kirche des Wüstenkreuzes, beinahe totgefahren hat, diesen harmlosen Wanderprediger, der Buße tut, indem er ein drei Meter großes Holzkreuz in der Nachfolge Christi durch die Wüste schleppt? Was zunächst im Dunkeln bleibt: John hat in einem früheren Leben Schuld auf sich geladen, es gibt in der Wüste jemanden, der das nicht vergessen kann.
Dieser John ist eine wahrhaft biblische Figur unter den vielen Geprügelten und Gestörten, die sich hier verkriechen im Niemandsland als Rückzugsort vor Steuerbehörden, Versicherungen, Staatsgewalt. Auch Phyllis, die eher in ein englisches Countryhouse passen würde und die dem halb so alten Ben Avancen macht, wirkt seltsam deplaziert. Trotz seines Vorstrafenregisters ist Ben Jones so etwas wie die Mutter Teresa der State Route 117. Er kann einfach nicht anders, als sich einzumischen, sein Leben einzusetzen für jene, die es noch schlechter getroffen haben als er.
Weder mangelt es an solchen Figuren, noch diesen an offenen Rechnungen. Rache ist ein zentraler Antriebsmotor dieses Romans, organisiertes Verbrechen ein anderer. Nicht genau das vermutlich, was Nietzsche im Sinn hatte, als er im "Zarathustra" schrieb, "mancher ging in die Wüste und tötete sich, weil er müde war, Schlacht und Schlachtfeld von Tugenden zu sein". Der Junge Juan entpuppt sich als Mädchen, und Bens Suche nach Pedro führen ihn und das Kind in den Abgrund.
Im Nachwort verrät Hans-Peter Eggenberger, eine Quelle von Andersons Prosa sei dessen lebenslange Beschäftigung mit Lyrik, mit Autoren wie Goethe, Rilke, Bulgakow, Márquez, Eudora Welty und Willa Cather. In der Tat ist seine sprachliche Ambition eine der Stärken dieses Romans, dem ein wenig mehr Ausgeglühtheit gutgetan hätte.
HANNES HINTERMEIER
James Anderson: "Lullaby Road". Kriminalroman.
Aus dem Amerikanischen von Harriet Fricke. Hrsg. von Wolfgang Franßen. Polar Verlag, Stuttgart 2020. 374 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH