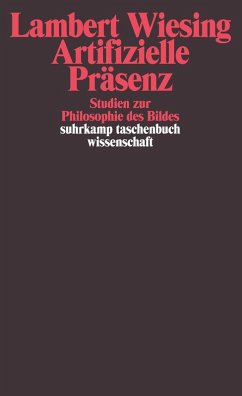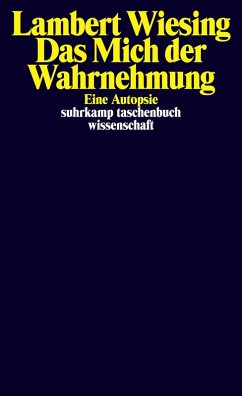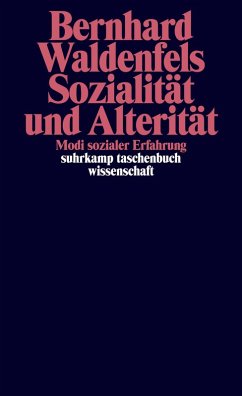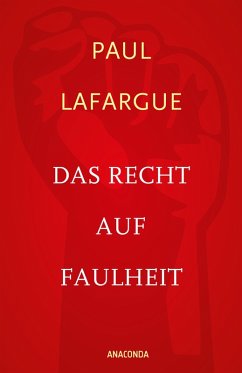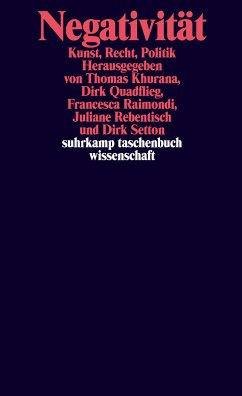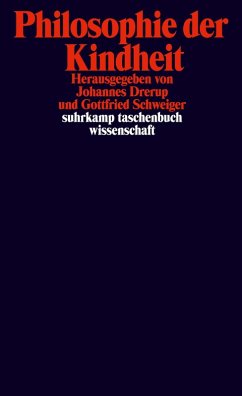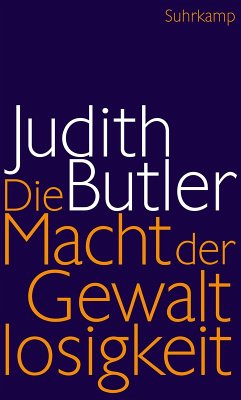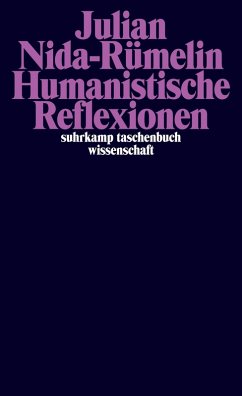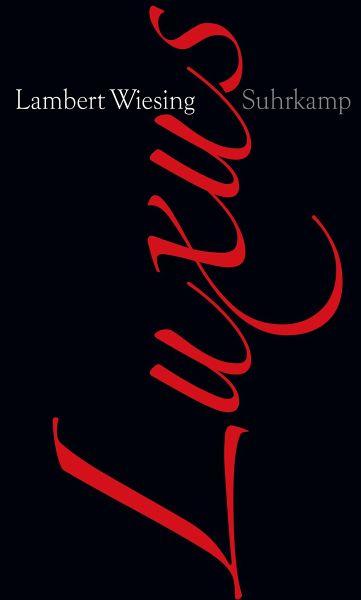
Luxus (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 30,00 €**
25,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Luxus ist der Dadaismus des Besitzens.« Luxus ¿ allein das Wort erzeugt vielfältige Vorstellungen: von teurem Schnickschnack, Überfluss und Verschwendung, von Reichtum und Komfort, Geltungskonsum und Statussymbolen. Und es provoziert offenbar klare Meinungen, denn Luxus wird zumeist entweder scharf verurteilt oder vehement verteidigt. Aber wissen die zahlreichen Kritiker und Apologeten des Luxus überhaupt, wovon sie reden? Es gibt nämlich keine Luxusforschung, die vor aller Bewertung systematisch zu bestimmen versucht, wann etwas Luxus ist. Daher steht die Antwort auf eine scheinbar ei...
»Luxus ist der Dadaismus des Besitzens.« Luxus ¿ allein das Wort erzeugt vielfältige Vorstellungen: von teurem Schnickschnack, Überfluss und Verschwendung, von Reichtum und Komfort, Geltungskonsum und Statussymbolen. Und es provoziert offenbar klare Meinungen, denn Luxus wird zumeist entweder scharf verurteilt oder vehement verteidigt. Aber wissen die zahlreichen Kritiker und Apologeten des Luxus überhaupt, wovon sie reden? Es gibt nämlich keine Luxusforschung, die vor aller Bewertung systematisch zu bestimmen versucht, wann etwas Luxus ist. Daher steht die Antwort auf eine scheinbar einfache Frage noch aus. Sie lautet: »Was ist Luxus?« Lambert Wiesing leistet in seinem neuen Buch Pionierarbeit, denn er beantwortet diese Frage, und zwar mit dezidiert phänomenologischen Mitteln. Er zeigt, dass Luxus keine Eigenschaft von Dingen oder Handlungen sein kann, sondern durch eine private ästhetische Erfahrung entsteht: die Erfahrung des Besitzens von etwas, das zwar einen Zweck erfüllt, sich darin aber nicht erschöpft. Wird das Besitzen einer übertriebenen, überflüssigen oder irrational aufwendigen Sache von einem autonomen Subjekt als die eigensinnige Befreiung aus einer vereinnahmenden Herrschaft des Zweckrationalismus und Effizienzdenkens erlebt, so ist das ¿ Luxus.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.