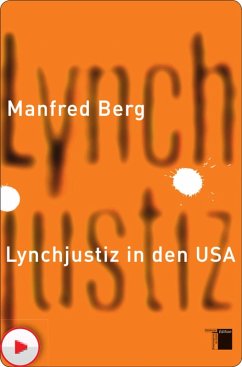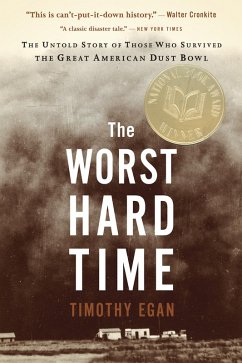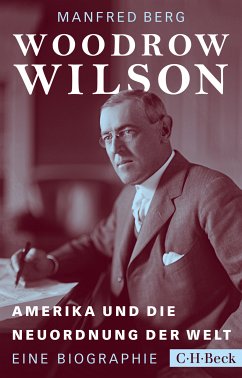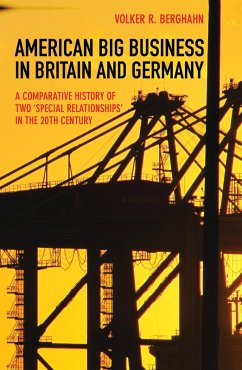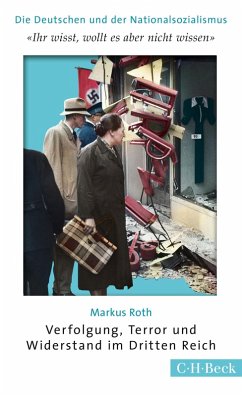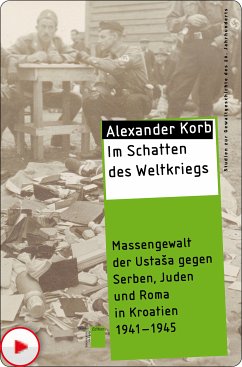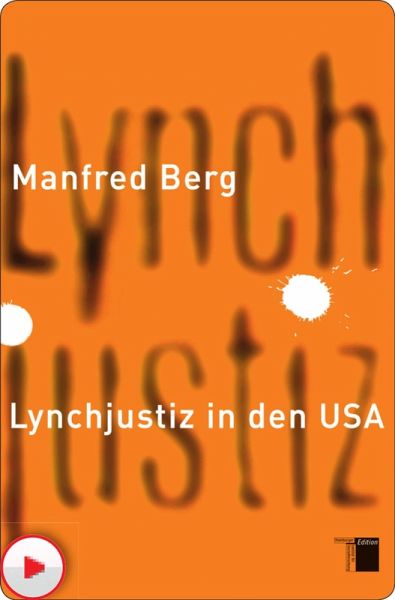
Lynchjustiz in den USA (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 32,00 €**
25,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Lynchjustiz - bis heute verbunden mit Rassismus, Terror und Gewalt, mit dem berüchtigten Ku-Klux-Klan und dem amerikanischen Süden - kostete im Lauf der amerikanischen Geschichte Zehntausende Menschen das Leben. Im Namen der "Gerechtigkeit", der "Selbstverteidigung des Volkes" und der "Vorherrschaft der weißen Rasse" wurden Menschen geteert und gefedert, gefoltert, gehängt oder verbrannt. Mehr oder weniger organisierte Gruppen, die den Anspruch erhoben, im Namen lokaler Gemeinschaften und einer höheren Gerechtigkeit zu handeln, nahmen sich das Recht heraus, angebliche Verbrecher zu bestra...
Lynchjustiz - bis heute verbunden mit Rassismus, Terror und Gewalt, mit dem berüchtigten Ku-Klux-Klan und dem amerikanischen Süden - kostete im Lauf der amerikanischen Geschichte Zehntausende Menschen das Leben. Im Namen der "Gerechtigkeit", der "Selbstverteidigung des Volkes" und der "Vorherrschaft der weißen Rasse" wurden Menschen geteert und gefedert, gefoltert, gehängt oder verbrannt. Mehr oder weniger organisierte Gruppen, die den Anspruch erhoben, im Namen lokaler Gemeinschaften und einer höheren Gerechtigkeit zu handeln, nahmen sich das Recht heraus, angebliche Verbrecher zu bestrafen. Manfred Berg erzählt die Geschichte der Lynchjustiz von ihren Anfängen in der Kolonialzeit und während der Revolution bis in die Gegenwart. Die rassistische Lynchjustiz gegen schwarze Amerikaner nimmt breiten Raum ein, aber der Historiker erinnert auch an andere, lange Zeit vergessene Opfergruppen wie Mexikaner und Chinesen. Er berichtet vom Widerstand gegen die Lynchjustiz und untersucht, warum sie um die Mitte des 20. Jahrhunderts aufhörte und welches Erbe sie in der amerikanischen Kultur hinterlassen hat. Wer verstehen will, warum das staatliche Gewaltmonopol in den USA eine vergleichsweise geringe Akzeptanz findet und die USA die drakonischste Strafjustiz der westlichen Welt praktizieren, aber auch welche Kontinuitäten zwischen dem Lynchen und der Praxis der Todesstrafe bestehen, findet in diesem Buch Antworten. Manfred Berg legt die erste deutschsprachige Gesamtdarstellung der Geschichte der Lynchjustiz in den USA vor, erweitert den Blick aber auch auf die aktuelle und weltweit geübte Praxis des Lynchens.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.