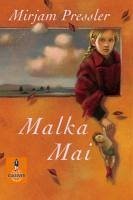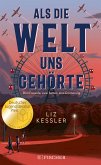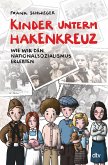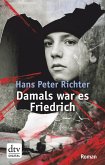Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Mirjam Presslers ergreifendes Buch über eine jüdische Kindheit
Ein rosa Kaninchen kann diesem Mädchen niemand mehr stehlen: Die sieben Jahre alte Malka Mai lebt als Straßenkind im Ghetto und leidet unter Hunger und Kälte. Ihre Puppe Liesl hat sie längst verloren, jetzt lernt sie, nach den Instinkten zu handeln. Die Überlebensstrategien, die das ehemals behütete jüdische Mädchen entwickelt, sind verblüffend.
Polen im Jahre 1943: Sechs Monate lang schlägt sich Malka ganz allein im Ghetto durch, ständig auf der Suche nach Nahrung und immer auf der Hut vor den Deutschen. Wie das Mädchen dorthin gekommen ist, schildern die Anfangskapitel von Mirjam Presslers Roman "Malka Mai". Zuerst lebt die Siebenjährige mit ihrer Mutter und der älteren Schwester friedlich in der kleinen Grenzstadt Lawoczne. Als die Deportationen auch dort beginnen, flieht die Familie in Richtung Ungarn. Dabei wird Malka auf dem anstrengenden Weg über die Karpaten krank. Die Mutter läßt sie schweren Herzens bei Bauern zurück, um sie nach der Genesung nachkommen zu lassen. Aber dann schicken die Bauern Malka weg: Sie zu verstecken sei zu gefährlich. Das Kind streunt von nun an alleine herum.
Selten findet man diesen so häufig in der Kinderliteratur bearbeiteten Stoff der Kindheit im Holocaust derart ergreifend aufbereitet wie hier. Da ist beispielsweise die Szene, als Malka zum ersten Mal ein totes Kind sieht: "Natürlich hatte sie im Ghetto schon Tote gesehen, sie lagen plötzlich irgendwo auf der Straße, und Malka machte dann einen Umweg und ging mit abgewandtem Gesicht vorbei. Aber diesmal war es anders, diesmal sah sie an der Größe, daß es ein Kind war." Lange überlegt Malka sich, ob sie nicht den Schal des Jungen gebrauchen könnte, doch ein anderer ist schneller. Dann erkennt das Mädchen, daß immer kurz nach den "Aktionen" der Deutschen, wenn Familien abgeholt werden, Essen liegenbleibt, und sie veranstaltet Haferflocken- und Marmeladeorgien in den verlassenen Häusern.
Szene für Szene reißt dieses Buch den Leser in den Strudel seiner verhängnisvollen Geschichte: Es scheint, als habe die Autorin, die in den achtziger Jahren Anne Franks Tagebücher übersetzte und dann eine Biographie über das Mädchen aus der Prinsengracht 263 verfaßte, sich hier freigeschrieben von dem Eindruck, den der Nachvollzug des historischen Wirklichkeit hinterließ. Dabei wird nicht nur aus Malkas Sicht erzählt, sondern - wie nur selten in der Kinderliteratur - streckenweise auch aus der Perspektive ihrer Mutter Hanna. Durch diese Dramaturgie kann beispielsweise Hannas Entschluß, das Mädchen bei Fremden zurückzulassen, überhaupt erst verständlich werden. Auch fällt so ein doppelter Blick auf Minna, Malkas ältere Schwester.
Es gibt kaum ein Detail in diesem Roman, das nicht wahrhaftig erscheint. Nur der Name der Heldin, "Malka Mai", mag in manchen Ohren arg nach Kinderliteratur klingen. Man ist überrascht festzustellen, daß es sich ausgerechnet dabei um ein Spurenelement der "wahren Geschichte" handelt, die diesem Roman zugrunde liegt. Malka Mai, die heute in Israel lebt, hatte einen kleinen Bericht über ihre Vergangenheit für die Dokumentensammlung der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem geschrieben, das der Verlag an Pressler schickte. Als die Schriftstellerin das nächste Mal in Israel war, besuchte sie die Überlebende. Aus diesen Eckdaten schließlich entstand "Malka Mai", ein Buch, das man so schnell nicht vergißt und das fortan zu den wichtigsten Werken der Autorin gehören wird.
SILKE SCHEUERMANN
Mirjam Pressler: "Malka Mai". Verlag Beltz & Gelberg, Weinheim 2001. 324 S., geb., 28,- DM. Ab 12 J.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main