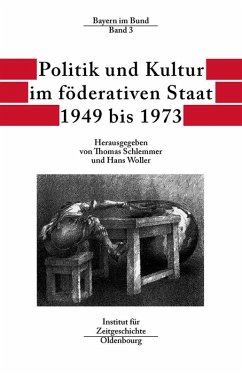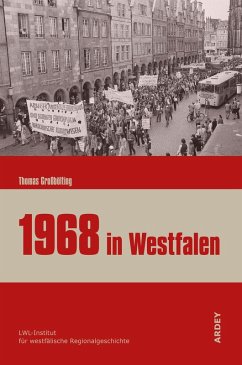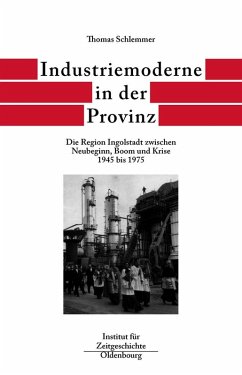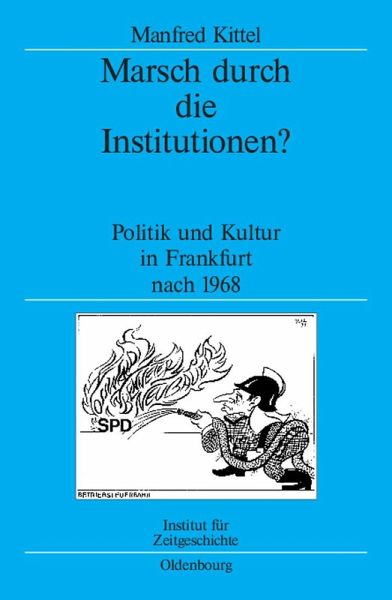
Marsch durch die Institutionen? (eBook, PDF)
Politik und Kultur in Frankfurt nach 1968

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Hat der von Rudi Dutschke verkündete Marsch der 68er-Bewegung "durch die Institutionen" der Bundesrepublik wirklich stattgefunden? Manfred Kittel nimmt mit Frankfurt am Main einen der Brennpunkte der Studentenrevolte in den Blick - und damit die Geschichte der lokalen Parteien, der Städtischen Bühnen und des Historischen Museums in den Jahren bis 1977, als Hilmar Hoffmann Kulturdezernent im traditionell sozialdemokratisch dominierten "Römer" war. Das "Frankfurter Modell" kommunaler Kulturpolitik fand bundesweit Aufmerksamkeit. Aber wie tiefgreifend und nachhaltig war der Wandel, den vor al...
Hat der von Rudi Dutschke verkündete Marsch der 68er-Bewegung "durch die Institutionen" der Bundesrepublik wirklich stattgefunden? Manfred Kittel nimmt mit Frankfurt am Main einen der Brennpunkte der Studentenrevolte in den Blick - und damit die Geschichte der lokalen Parteien, der Städtischen Bühnen und des Historischen Museums in den Jahren bis 1977, als Hilmar Hoffmann Kulturdezernent im traditionell sozialdemokratisch dominierten "Römer" war. Das "Frankfurter Modell" kommunaler Kulturpolitik fand bundesweit Aufmerksamkeit. Aber wie tiefgreifend und nachhaltig war der Wandel, den vor allem auch ein weitreichendes Mitbestimmungsmodell an den Städtischen Bühnen und ein neues Stadtmuseum "für die demokratische Gesellschaft" im Geiste von 1968 bewirkten?
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.