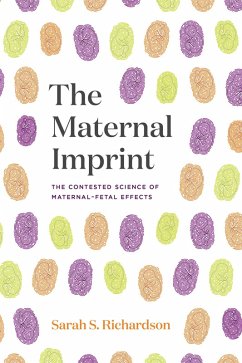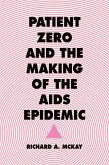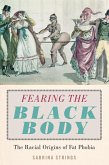Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Sarah Richardson wirft einen kritischen Blick auf die Forschungen zu den Effekten mütterlicher Prägung des heranwachsenden Fötus.
Anders als es die rasanten Entwicklungen innerhalb der Genetik in den vergangenen Jahrzehnten erwarten lassen, ist die moderne Medizin keineswegs einem durch und durch deterministischen Verständnis von Genen verbunden. Vor allem der Einfluss der Umwelt - und des mütterlichen Verhaltens - auf den sich im Mutterleib entwickelnden Fötus gilt als ein paradigmatisches Beispiel dafür, wie die Umwelt die Wirkung von Genen modulieren kann und wie solche Umwelteffekte über mehrere Generationen wirksam bleiben können. Die Vererbung erworbener Eigenschaften ist in der Medizin keine Häresie, sondern Grundlage eines enorm produktiven Forschungsprogramms. Die generationenübergreifenden Folgen der niederländischen Hungersnot im Winter 1944/45 oder die Weitergabe des Traumas von Holocaust-Überlebenden auf ihre Nachkommen sind zwei paradigmatische Beispiele für die Erkenntnisse dieser Forschungen. Dass Mütter während der Schwangerschaft einen besonderen Einfluss auf ihren Nachwuchs haben können, ist jedoch eine alles andere als neue Idee.
Die Wissenschaftshistorikerin Sarah Richardson stellt diese Forschung in ihren historischen Kontext und wirft einen kritischen Blick auf ihre Grundannahmen, Methoden und Schlussfolgerungen. In den ersten vier Kapiteln ihres Buches stellt Richardson konzis und anschaulich dar, wie sich das medizinische und wissenschaftliche Denken über den mütterlichen und väterlichen Beitrag zur Ausprägung des Nachwuchses entwickelte. Dreh- und Angelpunkt ihrer Darstellung ist August Weismanns Keimplasmatheorie (1882), die besagte, dass nur das in den Ei- oder Samenzellen befindliche Erbgut weitergegeben wird, dass Vater und Mutter den gleichen Beitrag zum Nachwuchs leisten, dass es gleichgültig ist, ob ein Erbfaktor von mütterlicher oder väterlicher Seite kommt, und dass es keine Vererbung erworbener Eigenschaften geben kann.
Weismanns Theorie - für die der Begriff "Neodarwinismus" geprägt wurde - bildete einen radikalen Bruch zu früheren Theorien der Fortpflanzung und Vererbung und war ein wesentliches Element in der Entwicklung der modernen Evolutionsbiologie. Von der Antike bis zum neunzehnten Jahrhundert wurde der Einfluss der Mutter und des Vaters als unterschiedlich beurteilt. Außergewöhnlich bedeutsam war die Vorstellung, dass Emotionen und Erfahrungen einer schwangeren Frau sich dem Fötus aufprägen können und zu Muttermalen, Missbildungen oder Persönlichkeitseigenschaften führen können. Andere Theorien sahen die weibliche Eizelle als ernährend and passiv, während das Spermium alle "Lebenskraft" beisteuerte. Eine dritte Klasse von Theorien gestand sowohl Ei als auch Spermium eine Rolle zu, die Beiträge der beiden Zelltypen wurden jedoch als komplementär betrachtet. Weismanns Theorie und ihre experimentelle Bestätigung räumten mit diesen Theorien auf, doch sie überlebten mehrere Jahrzehnte in einem Bereich, in dem progressive Politik eine Allianz mit positiver Eugenik einging, um eine moderne Gesellschaft mit gesunden Bürgern zu schaffen.
In der Genetik häuften sich in den zwanziger und dreißiger Jahren jedoch auch Fälle, die zeigten, dass bei Weizen, Schnecken und Fruchtfliegen manche Eigenschaften nicht den Mendelschen Vererbungsregeln folgen, sondern dass ein eindeutiger "mütterlicher Effekt" wirksam war - die Ausprägung eines Merkmals im Nachwuchs wurde von der Merkmalsausprägung der Mutter bestimmt, nicht von der Kombination mütterlicher und väterlicher Gene. Solche Phänomene wurden zwischen 1940 und 1970 intensiv in der Tierzüchtung untersucht, bevor amerikanische Humanmediziner sich für diese Thematik zu interessieren begannen. Die anhaltenden Unterschiede in der gesundheitlichen Verfassung von schwarzen und weißen Amerikanern wurden manchmal soziologisch erklärt - vor allem durch die Prävalenz von alleinerziehenden Müttern -, oder von Rassentheoretikern auf genetische Unterschiede zurückgeführt.
Die Kinderärzte Herbert Birch und Joan Gussow argumentierten 1970, dass über Generationen akkumulierte Schäden, die durch mütterlichen Stress und Mangelernährung hervorgerufen wurden, eine anhaltende Ungleichheit festschrieben. Das Geburtsgewicht und der Intelligenzquotient waren zunächst der Fokus dieser wissenschaftlichen Debatten. Mit der Weiterentwicklung molekulargenetischer Methoden und der Erkenntnis, dass Änderungen der Genfunktion ohne Änderungen der Gensequenz weitervererbt werden können, erfuhr die Wissenschaft des "fetal programming" seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts dann einen enormen Aufschwung. Tausende von Wissenschaftlern beschäftigen sich inzwischen mit der Frage, wie ein Stimulus oder eine schädliche Einwirkung während einer kurzen sensitiven Periode in der fötalen Entwicklung zu lebenslangen gesundheitlichen Folgen - Bluthochdruck, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen - führen kann.
Obwohl dieses Forschungsprogramm sich distanziert vom genetischen Determinismus und offen für soziale Erklärungsfaktoren ist, kritisiert Sarah Richardson die Methodik und die Schlussfolgerungen von Arbeiten zum fötalen Ursprung von Erkrankungen mit deutlichen Worten. Die gefundenen statistischen Effekte sind meist sehr klein, und statistische Störfaktoren oder Drittvariablen werden meist nicht oder nur ungenügend berücksichtigt. Ebenso wird in den meisten Studien der väterliche Einfluss nicht einbezogen. Eine Hypothese besagt, dass mütterliches Übergewicht während der Schwangerschaft das Risiko für Übergewicht beim Nachwuchs erhöht. Untersuchungen bestätigten zunächst diese Hypothese, doch eine detaillierte Analyse zeigte, dass das Gewicht des Vaters eine größere Rolle spielt. Und keine der umfangreichen Studien hat je zu irgendwelchen konkreten Maßnahmen beigetragen, die die Gesundheit von Neugeborenen und ihren Müttern verbesserten. Laut Richardson ist es klar, welche Maßnahme in den Vereinigten Staaten das kurz- und langfristig wäre: der Zugang zu Gesundheitszentren mit qualitativ hochwertiger Versorgung und Pflege. Keine andere Maßnahme hat einen vergleichsweise großen Effekt auf vor- und nachgeburtliche Sterblichkeit und auf die Gesundheit der Mütter. Die Forschung zur intrauterinen fötalen Prägung richten den Blick hingegen auf subtile Variationen in weitgehend normal verlaufenden Schwangerschaften und vernachlässigt Risikofaktoren mit weit größerer Wirkung, die allerdings oft sozio-ökonomischer Natur sind.
Richardsons durch und durch überzeugendes Buch zeigt, wie ein anti-deterministisches und anti-reduktionistisches Forschungsprogramm, wie es die Erforschung der mütterlichen Prägung des Fötus ist, auf diese Weise dazu dienen kann, von wirksamen gesundheitspolitischen Maßnahmen abzulenken. Es zeigt, einmal mehr, die ideologische Komplexität moderner Wissenschaft. THOMAS WEBER
Sarah S. Richardson: "The Maternal Imprint". The Contested Science of Maternal-Fetal Effects.
The University of Chicago Press. Chicago 2021. 376 S., geb., 89,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main