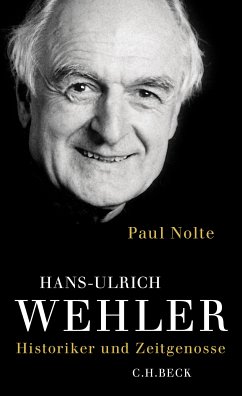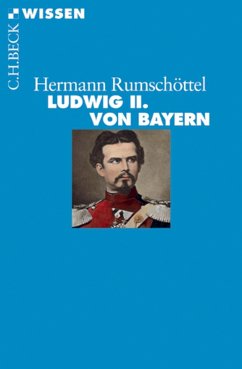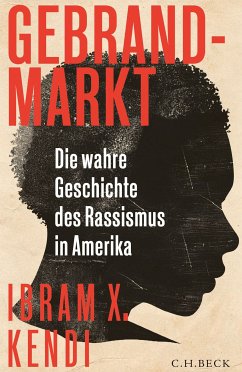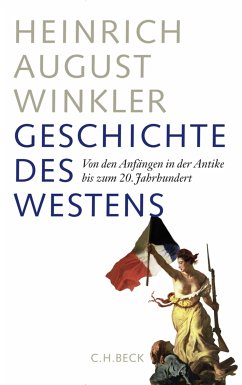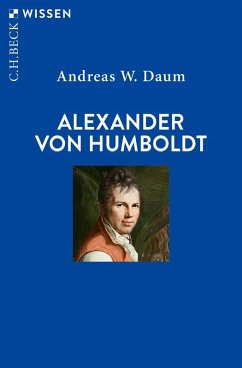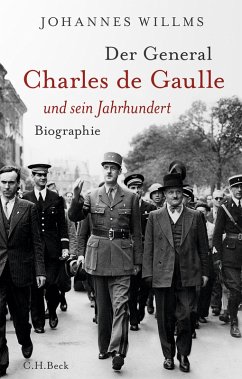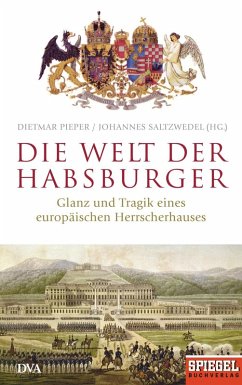Max Weber (eBook, ePUB)
Preuße, Denker, Muttersohn

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Max Weber ist einer der einflussreichsten Denker des 20.Jahrhunderts, doch er war nicht unser Zeitgenosse. Wer ihn verstehen will, muss eintauchen in die bürgerlichen Lebenswelten einer vergangenen Zeit. Dirk Kaesler zeigt in seiner lang erwarteten, glänzend erzählten Biographie den Menschen Max Weber in seiner Epoche ¿ den Jahren zwischen der Gründung des Deutschen Kaiserreichs und seinem Untergang. Nur wenige andere Denker werden so häufig als Interpret unserer Gegenwart in Anspruch genommen wie Max Weber. Etwa, wenn es um die Frage geht, ob Politiker ¿Charismä haben oder nicht, wenn...
Max Weber ist einer der einflussreichsten Denker des 20.Jahrhunderts, doch er war nicht unser Zeitgenosse. Wer ihn verstehen will, muss eintauchen in die bürgerlichen Lebenswelten einer vergangenen Zeit. Dirk Kaesler zeigt in seiner lang erwarteten, glänzend erzählten Biographie den Menschen Max Weber in seiner Epoche ¿ den Jahren zwischen der Gründung des Deutschen Kaiserreichs und seinem Untergang. Nur wenige andere Denker werden so häufig als Interpret unserer Gegenwart in Anspruch genommen wie Max Weber. Etwa, wenn es um die Frage geht, ob Politiker ¿Charismä haben oder nicht, wenn behauptet wird, dass Politik das ¿Bohren harter Bretter¿ sei oder wenn erörtert wird, ob der Protestantismus ¿Schuld¿ am Kapitalismus trage. Doch es war nicht unsere Welt, die Weber zu seinen Theorien inspirierte. Dirk Kaesler rekonstruiert die Entstehung von Webers Werk im Kontext der damaligen Ideen und Kontroversen, zeichnet seine wissenschaftlichen und politischen Aktivitäten nach und entschlüsselt eindrucksvoll den Menschen Max Weber. Dabei wird deutlich, wie sehr Leben und Werk dieses brillanten Theoretikers und düsteren Visionärs, dessen eigentliche Leidenschaft der Politik galt, geprägt waren durch seinen familiären Hintergrund, durch Vorfahren, Eltern und Verwandte, durch alte Kaufmannsdynastien, aufgeklärte Protestantinnen und einen pragmatischen Politiker.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.