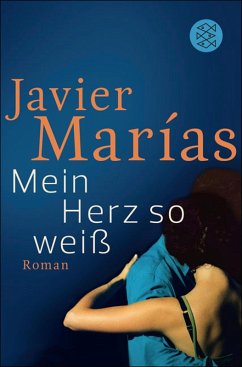Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Javier Marías schreibt einen großen Roman über Täter und Komplizen / Von Paul Ingendaay
Wenn auf der ersten Seite eines Romans von einem Selbstmord erzählt wird, dann ist das ein ernster Beginn mit Aussicht auf die letzten Dinge des Lebens. Wenn die Selbstmörderin aber jung ist und schön, ihre Haut blaß, der Blick verschattet, dann schrumpft das Grundsätzliche zum romantischen Geheimnis zusammen, von dem jeder zu wissen glaubt, womit es zu tun hat: mit einem Mann. Dem spanischen Schriftsteller Javier Marías war das durchaus bewußt. Trotzdem beginnt sein Roman "Mein Herz so weiß" (Corazón tan blanco) mit folgendem Satz: "Ich wollte es nicht wissen, aber ich habe erfahren, daß eines der Mädchen, als es kein Mädchen mehr war, kurz nach der Rückkehr von der Hochzeitsreise das Badezimmer betrat, sich vor den Spiegel stellte, die Bluse aufknöpfte, den Büstenhalter auszog und mit der Mündung der Pistole ihres eigenen Vaters, der sich mit einem Teil der Familie und drei Gästen im Eßzimmer befand, ihr Herz suchte."
Man ist gut beraten, die sieben Seiten, die auf den Tod der schönen Teresa folgen, als gezieltes Verschleierungsmanöver des Autors zu lesen. Auf diesen Seiten beschreibt Marías das Durcheinander, das ein Selbstmord in den Räumen einer wohlhabenden Familie anrichtet. Der Vater hat soeben einen Bissen genommen, als der Schuß fällt, und da er ihn weder hinunterschluckt noch auf den Teller spuckt, wankt er mit vollem Mund ins Badezimmer, wo er die grausige Szenerie erblickt, den Wasserhahn abdreht, mit der Serviette den Büstenhalter seiner Tochter bedeckt, den Bissen noch immer im Mund. Die Gäste, darunter ein Arzt, drängen nach. Die Schwester wischt der Toten die Tränen ab. Im Eßzimmer serviert das Dienstmädchen eine Eistorte. Von draußen hört man den Pfiff des Ladenjungen, der seine Kisten ablädt. Das Dienstmädchen ist unschlüssig, weil die Eistorte zu schmelzen droht. Inzwischen hat der Vater sein Mittagessen, darunter den heimtückischen Bissen, im Badezimmer wieder von sich gegeben.
Mit großer Genauigkeit, fast pedantisch leuchtet Marías die Räume des Hauses aus; der Leser soll kein Detail versäumen. Dann, als wir an die verschiedenen Blickwinkel gewöhnt sind, als der Ladenjunge sein Pfeifen eingestellt und das Dienstmädchen sich die Schürze gerichtet hat und alle, selbst die Köchin, ihren Auftritt gehabt haben, dann erst, endlich, kommt Ranz nach Hause, Teresas Ehemann, eine Fahne von Kölnisch Wasser weht ihm voran. Der Schauplatz ist immer noch erleuchtet. So beschäftigt sind wir mit der brillant geschriebenen Szene, daß wir kaum bemerken, wie der Erzähler, der nur im allerersten Satz "ich" gesagt hat, sich nun abermals ins Spiel bringt und im letzten Satz des Kapitels seine Identität enthüllt: "Alle sagten, Ranz, der Schwager, der Ehemann, mein Vater, habe großes Pech gehabt, da er zum zweiten Male Witwer geworden sei."
Mit den Rätseln dieser Eröffnung könnte man einen hübschen Roman bauen, der von verjährter Schuld und später Erkenntnis handelt, von einem Sohn, der die Wahrheit über seinen Vater sucht, und allgemein von den Phantasmen unterdrückter Geschichten. Doch was wäre dann? Wenige Autoren fragen sich ja, was ihre Figuren mit der Wahrheit anfangen, wenn sie einmal zutage liegt, und ob sie überhaupt in ihr Leben paßt. Genau dort setzt Marías an. Ihn interessiert nicht die Enthüllung um ihrer selbst willen, sondern - wie seinen Lehrmeister Joseph Conrad - die moralische Versuchsanordnung, in der sich das Handeln der Figuren zu erkennen gibt und überprüfen läßt. Was die Figuren mit der Erkenntnis dann machen, ist ihre Sache, und meistens geht es nicht gut aus.
Juan, der Erzähler, ist Ranz' Sohn aus dessen dritter Ehe mit Teresas jüngerer Schwester. Die Tante ist für ihn zunächst nur eine Anekdote aus der Zeit vor seiner Geburt; von den Umständen ihres Todes hat er erst vor kurzem erfahren. Die 360 Seiten des Romans erzählen vor allem seine Geschichte, die Geschichte eines fünfunddreißigjährigen Spaniers, der auf internationalen Konferenzen dolmetscht und ein Jahr zuvor geheiratet hat. Leider muß er immer noch viel reisen, nach Brüssel, Genf und New York. Die Ruhe, mit der er seine Erinnerungen sortiert und vor dem Leser ausbreitet, ist trügerisch. Bisher mag er sich mit gerahmten Fotos und geglätteten Familiengeschichten zufriedengegeben haben, doch das ist vorbei.
Denn diesen intelligenten, ironiefähigen Erzähler erfaßt eine merkwürdige Unruhe, als er Luisa heiratet, eine Berufskollegin. Im Grunde beunruhigt ihn, daß Eheleute paarweise auftreten, daß sie dieselben Ziele haben sollen und daß auf dem breiten Bett zwei Kopfkissen liegen statt auf dem schmalen Bett eines. Er braucht nicht von der Tyrannei der Intimität zu reden, denn er meint etwas viel Gefährlicheres: daß dieselbe Geste - der Mund des einen am Ohr des anderen - sowohl Trost als auch Anstiftung bedeuten kann. Und so beginnt Juan, "im Vorgefühl aller möglichen Katastrophen zu leben, ähnlich wie jemand, der sich eine jener ansteckenden Krankheiten zuzieht, von denen man nicht mit Sicherheit weiß, wann man von ihnen geheilt werden kann".
Das medizinische Vokabular von Proust, der Bewußtseinszustände als "inoperabel" bezeichnete, taucht hier nicht zufällig auf. Auch Javier Marías erweist sich als glänzender Psychologe, freilich als einer, der dem Patienten den Befund verschweigt. Spürbar sind für Juan nur die Vorfälle selbst, die ihn immer tiefer in die Krankheit treiben. In Kuba, auf der Hochzeitsreise, belauscht er ein Gespräch im Nebenzimmer: Ein spanischer Geschäftsmann beruhigt seine kubanische Geliebte, daß seine Frau, daheim in Spanien, im Sterben liege und der Weg für ihn und die Geliebte bald frei sei. Die Geliebte glaubt ihm nicht und verlangt von dem Geschäftsmann, seine Frau zu töten.
Der Ohrenzeuge kann die Geschichte nicht vergessen. Als müßte er sie als Radiostück inszenieren, kehrt sie in seiner Vorstellung wieder, überlagert andere Ereignisse und verdichtet sich zu einem konspirativen Zusammenhang. Er glaube nicht an Wiederholungen, versichert der Erzähler immer wieder; überhaupt hat er manche schöne Theorie über den Zufall, das Schicksal und so weiter, die darauf hinauslaufen, daß im großen Einerlei von Geschehenem und Ungeschehenem keine moralischen Unterscheidungen mehr möglich seien. Dennoch legt er im nächsten Moment wieder das Ohr an die Wand, weil er fürchtet, er könnte Entscheidendes verpassen.
Es steckt eine gehörige Ironie darin, daß ausgerechnet ein Dolmetscher vor der Macht "herrenloser Worte" zu zittern beginnt: "Die Ohren haben keine Lider, die sich instinktiv vor dem Ausgesprochenen schließen können." Was Marías hier in der Entstehung vorführt, ist das Bewußtsein von Komplizenschaft. Auch wo es keinen Schaden anrichtet, setzt es voraus, daß Menschen sich einander offenbaren. Juan jedoch - das ist das Defizit, das seine Rhetorik kunstvoll verhüllt - vermutet Komplizenschaft, sogar Verrat und Mord, ohne sich offenbart zu haben. Um seiner ehemaligen Geliebten Berta in New York zu helfen, tut er viel: Er beschattet einen Fremden, der sich auf eine Kontaktanzeige gemeldet hat; er dreht ein intimes Video, das Berta dem Fremden schickt; er schlägt sich eine Nacht um die Ohren, damit Berta den Fremden empfangen kann. All das könnte als achtbarer Freundschaftsdienst durchgehen, wenn es nicht noch etwas anderes wäre: die Teilnahme an fremden Offenbarungen, ohne die Deckung zu verlassen.
Den literarischen Bezug seines Romans, den Elke Wehr in ein leuchtendes Deutsch übertragen hat, legt Javier Marías freimütig offen, schon der Titel zeugt davon. Es ist einerseits die Anstiftung zum Mord durch Lady Macbeth und andererseits die Grenze, die sie zwischen sich und dem Mörder zieht, ihrem Ehemann, als sie nach der Tat zu Macbeth sagt: My hands are of your colour; but I shame / To wear a heart so white. ("Meine Hände sind blutig, wie die deinen; doch ich schäme mich, daß mein Herz so weiß ist.")
Bei der kalt planenden Lady Macbeth klingt das weiße Herz, wenn es kein makabrer Scherz ist, nach einer Doppelstrategie von Nähe und Distanzierung. Was die literarische Figur bedeutungsvoll offen läßt, bedrängt den Helden von Marías: In schärferen Umrissen taucht das alte Geheimnis seines Vaters wieder auf, aber nicht als Kriminalfall, sondern als Virus, der auf das geschwächte Immunsystem des Sohnes überspringt. Juan erfährt, Ranz habe auch seine erste Frau, eine Kubanerin, durch einen gewaltsamen Tod verloren. Allein im dunklen Schlafzimmer liegend, hört er unbemerkt mit, als Ranz gegenüber Luisa seine Geschichte preisgibt. Tatsächlich handelt sie von unbedacht gesprochenen Worten, die sich verselbständigten, von einem Mord, der leicht zu verbergen war und den Mörder vierzig Jahre beschäftigte, ohne daß sein Gewissen ihn gehindert hätte, sich einen eleganten Mantel zu kaufen und morgens sein Haar zu pudern.
Nur wer den Autor an diesem Punkt nicht begriffen hat, könnte ihm wegen der Weigerung, eine Beichte mit Zerknirschung und Reue zu liefern, moralische Gleichgültigkeit vorwerfen. Wie sollte er das anstellen, wo alle Säulen, auf denen die Konstruktion ruht, am Ende des Buches weggebrochen sind? Ebendarin liegt die Entzauberung, die Javier Marías in seinem grandiosen Roman vornimmt. Er hebt den Mechanismus von Schuld und Bekenntnis auf, weil er nicht daran glaubt, daß Geständnisse die Welt besser machen - nicht den Mörder, aber auch nicht seinen weltlichen Beichtvater.
Javier Marías: "Mein Herz so weiß". Roman. Aus dem Spanischen übersetzt von Elke Wehr. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1996. 365 S., geb., 36,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main