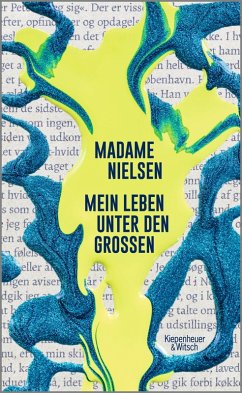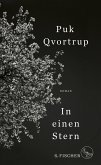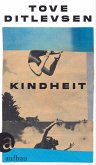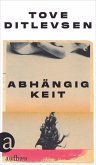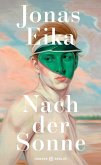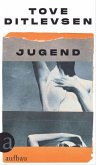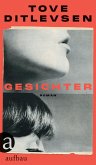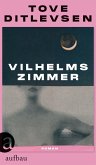Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Wer interessiert sich im deutschsprachigen Raum für eine dänische Literaturgeschichte der Gegenwart, für den dänischen Literaturbetrieb? Vergnüglicher und interessanter als mit der Lektüre des vorliegenden Buchs von Madame Nielsen wird man mit der Materie kaum vertraut gemacht werden können, so viel ist sicher. Madame Nielsen, Performerin, Sängerin, Schauspielerin und Autorin hat ihre wahrscheinlich in der beschriebenen Genauigkeit eher imaginierten als selbst erlebten Begegnungen mit zwölf Großen der gegenwärtigen Literatur in Dänemark in diesem Buch zusammengefasst, das gleichzeitig wohl viel Biographisches über die Künstlerpersönlichkeit preisgibt, die bis 2001 als Claus Beck-Nielsen lebte und sich seitdem (nach ein paar weiteren Pseudonymen) Madame Nielsen nennt. Die Entscheidung, als Frau zu leben, kam unter anderem mit der Einsicht, dass Beck-Nielsen dann besser aussehen würde.
Jedenfalls zeichnet das Buch den Weg des jungen Künstlers über ein Dachbodenzimmer in die und mit der Kopenhagener Boheme nach, verliert sich aber Gott sei Dank nicht im spätpubertär-mühevollen poetischen Schaffensprozess, der mit diesem Weggang von zu Hause in der Provinz stattfinden sollte. Madame Nielsen geht gleich in die Vollen: Der Erzähler reicht ein paar Gedichte bei einer Literaturzeitschrift ein, deren poetischen Wert die Imprägnierung mit etwas aus der Boheme-Speisekammer geklauter Roter Bete steigern sollte. Was nicht hinhaut, allerdings werden ein paar der neun Gedichte immerhin - ohne Rote-Bete-Flecken - gedruckt. Was Ausgangspunkt für die Imaginationen von Begegnungen mit bekannten und teilweise auch bedeutenden dänischen Autoren wird.
Madame Nielsen erzählt schnell und komisch; die Komik rührt von blitzsauberer Selbstironie ebenso her wie aus sehr raschen Beobachtungen schräg an den Sachen entlang: "Erst neulich, oder vielleicht liegt das auch schon einige Jahre in der Zukunft, bin ich Peter Høeg begegnet, oder habe ihn genauer gesagt wiedergesehen, zum zweiten Mal in meinem Leben. Es geschieht sozusagen aus verhangenem Himmel. Ich war gerade in meinem Verlag, ja, wie alle anderen mehr oder weniger großen Autoren unseres Landes habe ich jetzt auch einen Verlag, oder besser, sie haben mich, nur was sie mit mir wollen, weiß ich beim besten Willen nicht, ein gutes Geschäft bin ich jedenfalls kaum, im Gegenteil, ich bin wohl der führende Worstseller Dänemarks, aber das weiß zum Glück keiner außer mir." So ging es zu bei der Begegnung mit dem Verfasser von "Fräulein Smillas Gespür für Schnee".
Die Einfälle von Madame Nielsen jagen einander durch das ganze Buch; trotz des nun einmal immer grundsätzlich Gegebenen des Erzählens, der Abfolge von "Und dann passierte das und dann das und dann das" entsteht ein großes Porträt einer - meinethalben - Abendgesellschaft; alle dänischen Dichter, die Madame Nielsen noch getroffen haben könnte, treffen sich zu einem komischen Fest. Alle trinken ziemlich viel - kein skandinavisches Künstlerleben ohne Alkohol -, und alle agieren haarscharf aneinander vorbei, der Ich-Erzähler immer mittenmang. Dass es dreizehn sind, macht die Sache nicht beziehungsärmer - eine Art letztes Fest vor dem bildungsbedingten Untergang der Spezies "Autor" könnte in tieferen Schichten des dichten Textes beschworen sein.
Zu den dreizehn kommen noch ein paar weitere Figuren, welche die Claims dieses absolut gegen den Strich erzählten Großporträts dänischer Gegenwartsdichtung abzustecken haben: Hans Christian Andersen, fast möchte man sagen: natürlich, als Dreh- und Angelperson, aber vor allem Johannes Vilhelm Jensen, der 1950 gestorbene dänische Nobelpreisträger und glänzende Erzähler über die dänische Provinz mit seinen "Himmerlandgeschichten". Nicht namentlich genannt, aber in einer Passage präsent ist der schwedische Dramatiker Lars Norén. Die existenziellen Erfahrungen, von denen Madame Nielsens Ich-Erzähler berichtet, belegen auch eine gut spürbare Nähe zum ersten großen skandinavischen Roman über ein Boheme-Leben: Knut Hamsuns "Hunger" aus dem Jahr 1890.
Der Gegensatz von Metropole und Land ist - neben den Autorenbegegnungen - ein sehr großes Thema des Buchs. Kopenhagen (oder Stockholm oder Oslo) als Verheißung eines wirklichen Lebens und nicht nur eines Dahinvegetierens in der öden und einsamen Provinz, dies soziokulturell tief in der Geschichte der skandinavischen Länder gegründete Versprechen löst Madame Nielsens Buch auch ein. An vielen Stellen darin erstarren die idyllischen Züge der Provinz und der kleineren Städte; die Weltgewandtheit mancher der geschilderten, zum Teil berühmt gewordenen Schriftsteller und Dichter rührt von ihrem rigorosen Weggang aus der Provinz her. Der Echoraum, den zu bauen sie sich anschicken, liegt im weiteren Europa. Doch aus Kopenhagen kann man ganz schwer wegziehen, heißt es sinngemäß an einer Stelle.
Das Buch wurde in Dänemark begeistert aufgenommen, und Hannes Langendörfers sehr gelungene Übersetzung ins Deutsche könnte dafür sorgen, dass der im deutschsprachigen Raum bereits gut bekannte Autor Madame Nielsen zu Recht noch bekannter und vor allem gelesener wird. STEPHAN OPITZ
Madame Nielsen: "Mein Leben unter den Großen".
Aus dem Dänischen von Hannes Langendörfer.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024. 224 S., geb.,
24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.
Wer interessiert sich im deutschsprachigen Raum für eine dänische Literaturgeschichte der Gegenwart, für den dänischen Literaturbetrieb? Vergnüglicher und interessanter als mit der Lektüre des vorliegenden Buchs von Madame Nielsen wird man mit der Materie kaum vertraut gemacht werden können, so viel ist sicher. Madame Nielsen, Performerin, Sängerin, Schauspielerin und Autorin hat ihre wahrscheinlich in der beschriebenen Genauigkeit eher imaginierten als selbst erlebten Begegnungen mit zwölf Großen der gegenwärtigen Literatur in Dänemark in diesem Buch zusammengefasst, das gleichzeitig wohl viel Biographisches über die Künstlerpersönlichkeit preisgibt, die bis 2001 als Claus Beck-Nielsen lebte und sich seitdem (nach ein paar weiteren Pseudonymen) Madame Nielsen nennt. Die Entscheidung, als Frau zu leben, kam unter anderem mit der Einsicht, dass Beck-Nielsen dann besser aussehen würde.
Jedenfalls zeichnet das Buch den Weg des jungen Künstlers über ein Dachbodenzimmer in die und mit der Kopenhagener Boheme nach, verliert sich aber Gott sei Dank nicht im spätpubertär-mühevollen poetischen Schaffensprozess, der mit diesem Weggang von zu Hause in der Provinz stattfinden sollte. Madame Nielsen geht gleich in die Vollen: Der Erzähler reicht ein paar Gedichte bei einer Literaturzeitschrift ein, deren poetischen Wert die Imprägnierung mit etwas aus der Boheme-Speisekammer geklauter Roter Bete steigern sollte. Was nicht hinhaut, allerdings werden ein paar der neun Gedichte immerhin - ohne Rote-Bete-Flecken - gedruckt. Was Ausgangspunkt für die Imaginationen von Begegnungen mit bekannten und teilweise auch bedeutenden dänischen Autoren wird.
Madame Nielsen erzählt schnell und komisch; die Komik rührt von blitzsauberer Selbstironie ebenso her wie aus sehr raschen Beobachtungen schräg an den Sachen entlang: "Erst neulich, oder vielleicht liegt das auch schon einige Jahre in der Zukunft, bin ich Peter Høeg begegnet, oder habe ihn genauer gesagt wiedergesehen, zum zweiten Mal in meinem Leben. Es geschieht sozusagen aus verhangenem Himmel. Ich war gerade in meinem Verlag, ja, wie alle anderen mehr oder weniger großen Autoren unseres Landes habe ich jetzt auch einen Verlag, oder besser, sie haben mich, nur was sie mit mir wollen, weiß ich beim besten Willen nicht, ein gutes Geschäft bin ich jedenfalls kaum, im Gegenteil, ich bin wohl der führende Worstseller Dänemarks, aber das weiß zum Glück keiner außer mir." So ging es zu bei der Begegnung mit dem Verfasser von "Fräulein Smillas Gespür für Schnee".
Die Einfälle von Madame Nielsen jagen einander durch das ganze Buch; trotz des nun einmal immer grundsätzlich Gegebenen des Erzählens, der Abfolge von "Und dann passierte das und dann das und dann das" entsteht ein großes Porträt einer - meinethalben - Abendgesellschaft; alle dänischen Dichter, die Madame Nielsen noch getroffen haben könnte, treffen sich zu einem komischen Fest. Alle trinken ziemlich viel - kein skandinavisches Künstlerleben ohne Alkohol -, und alle agieren haarscharf aneinander vorbei, der Ich-Erzähler immer mittenmang. Dass es dreizehn sind, macht die Sache nicht beziehungsärmer - eine Art letztes Fest vor dem bildungsbedingten Untergang der Spezies "Autor" könnte in tieferen Schichten des dichten Textes beschworen sein.
Zu den dreizehn kommen noch ein paar weitere Figuren, welche die Claims dieses absolut gegen den Strich erzählten Großporträts dänischer Gegenwartsdichtung abzustecken haben: Hans Christian Andersen, fast möchte man sagen: natürlich, als Dreh- und Angelperson, aber vor allem Johannes Vilhelm Jensen, der 1950 gestorbene dänische Nobelpreisträger und glänzende Erzähler über die dänische Provinz mit seinen "Himmerlandgeschichten". Nicht namentlich genannt, aber in einer Passage präsent ist der schwedische Dramatiker Lars Norén. Die existenziellen Erfahrungen, von denen Madame Nielsens Ich-Erzähler berichtet, belegen auch eine gut spürbare Nähe zum ersten großen skandinavischen Roman über ein Boheme-Leben: Knut Hamsuns "Hunger" aus dem Jahr 1890.
Der Gegensatz von Metropole und Land ist - neben den Autorenbegegnungen - ein sehr großes Thema des Buchs. Kopenhagen (oder Stockholm oder Oslo) als Verheißung eines wirklichen Lebens und nicht nur eines Dahinvegetierens in der öden und einsamen Provinz, dies soziokulturell tief in der Geschichte der skandinavischen Länder gegründete Versprechen löst Madame Nielsens Buch auch ein. An vielen Stellen darin erstarren die idyllischen Züge der Provinz und der kleineren Städte; die Weltgewandtheit mancher der geschilderten, zum Teil berühmt gewordenen Schriftsteller und Dichter rührt von ihrem rigorosen Weggang aus der Provinz her. Der Echoraum, den zu bauen sie sich anschicken, liegt im weiteren Europa. Doch aus Kopenhagen kann man ganz schwer wegziehen, heißt es sinngemäß an einer Stelle.
Das Buch wurde in Dänemark begeistert aufgenommen, und Hannes Langendörfers sehr gelungene Übersetzung ins Deutsche könnte dafür sorgen, dass der im deutschsprachigen Raum bereits gut bekannte Autor Madame Nielsen zu Recht noch bekannter und vor allem gelesener wird. STEPHAN OPITZ
Madame Nielsen: "Mein Leben unter den Großen".
Aus dem Dänischen von Hannes Langendörfer.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024. 224 S., geb.,
24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.