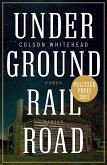In Mary Ruefles 41 Prosaminiaturen wird das Profane, werden Obsessionen, Sehnsüchte und widersprüchliche Neigungen zum Katalysator von Erkenntnis. Mit Lakonie, Humor und einer beneidenswerten Gabe des Hinsehens stellt Ruefle die genau richtigen Fragen an das Leben und erschließt en passant die Traurigkeit und Schönheit unseres alltäglichen Tuns.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Mary Ruefles flirrende Prosaminiaturen "Mein Privatbesitz"
Was eigentlich ist das, Privatbesitz? Und erst recht: "mein" Privatbesitz? Man denkt an Schubladen, in denen sich Erinnerungen oder Reichtümer stapeln. Objekte intensiver Begegnungen und von großer Bedeutung - vielleicht gar von großem Wert. Tatsächlich werden in der titelgebenden Geschichte dieses Bandes äußerst spezielle Privatbesitze erkundet, Schrumpfköpfe. Das "Mein" des Titels also ist nicht primär possessiv, sondern primär imaginativ, aber: Jede Imagination ist - immer auch - eine Besitznahme.
Mary Ruefle, eine Autorin, die in den Vereinigten Staaten schon lange als eine der glänzendsten Dichterinnen unserer Zeit gilt, hat ein großes Werk aus Gedichten und Kurzprosa geschaffen; außerdem erschien 2017 der Essayband "Madness, Rack and Honey". Mehr noch als Prosa, sagt sie, sei Poesie für sie eine Unterbrechung der Gegenwart, genauer: eine Aufhebung der Zeit, eine Sprachschleife im Kopf. Ihre Prosa setzt meist bei einer Erfahrung oder einem Thema an: "Die Prosa ist auf eine Weise vorbereitet, wie es die Gedichte nicht sind."
Der Band "Mein Privatbesitz" besteht aus 41 flirrenden Prosaminiaturen. Sie handeln meist von alltäglichen Dingen - von der Menopause und dem Füttern der Finken, von Schlüsseln und Brotkrümeln, vom ersten klassischen Konzert, das das erzählende Ich hörte, vom Scheitern in der Liebe und von einem Mitschüler, dem "starrköpfigen Frank". Außerdem sind die Themen des Lebens präsent: das Spiel, der Tod, die Kindheit. Alles ist meisterhaft übersetzt von der Dichterin und Autorin Esther Kinsky. Noch jedes Atom will ja gesehen und gegrüßt sein. Aber nicht nur das: Die Miniaturen haben in der Sache auf Anhieb keine Verbindungen untereinander. Alle beginnen aus dem Nichts und entschwinden nach dem letzten Wort scheinbar ebendorthin.
Eingestreut allerdings hat Ruefle elf kurze Abhandlungen über verschiedenfarbige Traurigkeiten, darunter Rosa, Lila, Schwarz und Grün. Bei Rosa heißt es: "Rosa Traurigkeit ist die Traurigkeit weißer Anchovis; . . . es ist die Traurigkeit der Scham, wenn man nichts falsch gemacht hat." Am Ende des Bandes notiert Ruefle, dass man das Wort "Traurigkeit" ebenso gut durch das Wort "Freude" ersetzen könne, Dass es auch im Deutschen funktioniert, ist ein Verdienst der Übersetzerin, denn es bedeutet, dass die Sprache die Kraft hat, Gegensätze zu bergen.
Was die Miniaturen außerdem verbindet, ist die Ahnung, dass das Privateste das Universellste ist. So auch in der Titelgeschichte mit den Schrumpfköpfen. In dem sich langsam entwickelnden Weg der Assoziationen changieren Erschrecken, Trauer und große Zärtlichkeit. Im Zentrum steht auch hier, wie überall, das Erinnern. Abwechselnd wähnen wir uns in einem Horrorkurzfilm, in dem knapp und detailreich die hohe Kunst der Herstellung von Schrumpfköpfen beschrieben wird; wir haben teil, wie die Ich-Erzählerin als Jugendliche zu den Objekten der Raubkunst und den kolonialen Siegestrophäen ins belgische Kongo-Museum pilgerte, um mit ihnen auf der Suche nach Gott Zwiegespräche zu führen. Wir sehen sie als Puppenköpfe. Wir lernen ihre Bedeutung als Objekte ferner Totenkulte kennen und sehen uns mit unserer eigenen Hilflosigkeit im Umgang mit dem Tod konfrontiert.
Der Dichter Paul Valéry notierte einmal, dass die Anfangszeile eines jeden Gedichts einer herabfallenden Frucht gleiche. Die Aufgabe des Dichters sei es dann, den Baum zu erschaffen, von dem die Frucht herabgefallen sein könnte. Und in der Tat, die zentrale Langminiatur "Mein Privatbesitz" liefert uns einen enormen Baum mit ungeahnten Wurzel- und Astformationen: Der Psychoanalytiker (englisch shrink, weil die Patienten in die Kindheit zurückschrumpfen) taucht ebenso auf wie das Krankenbett der sterbenden Mutter und die Versammlung der zwölf Schrumpfköpfe, die das lyrische Ich am liebsten zu Privatgesprächen um sich scharen würde. Was schließlich sind Paul Valéry, Franz Kafka, Emily Dickinson oder die eigene Mutter anderes als Köpfe, die in unsere Gegenwart hineinsprechen?
Mary Ruefle ist in Deutschland noch zu entdecken; die Literaturzeitschrift "Schreibheft" stellte sie zuerst vor. Ihre Kunst ist aus intensiver Imagination, großartiger Achtsamkeit und bei aller Skurrilität aus menschenfreundlichem Humor gemacht. MARIE LUISE KNOTT
Mary Ruefle: "Mein Privatbesitz".
Aus dem Englischen von Esther Kinsky. Suhrkamp Verlag, Berlin 2022. 127 S., geb., 18,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main