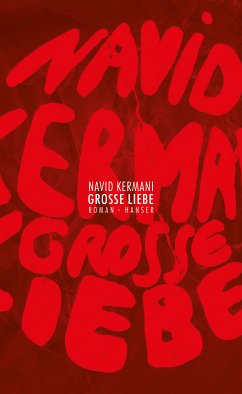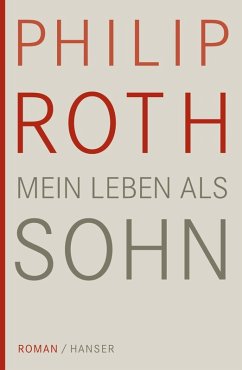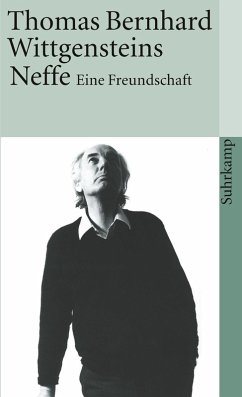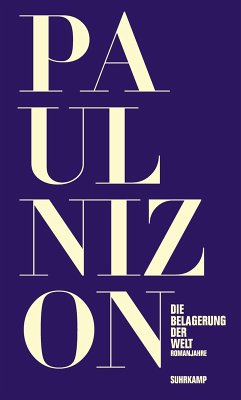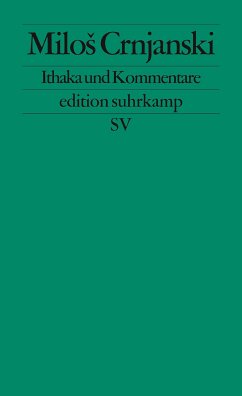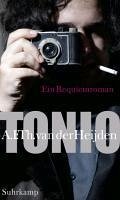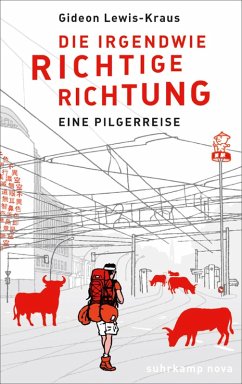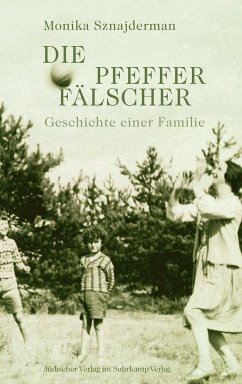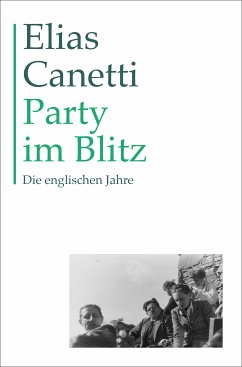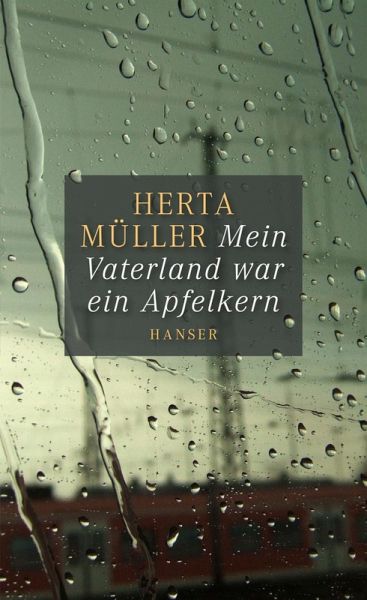
Mein Vaterland war ein Apfelkern (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,90 €**
10,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Ich stehe (wie so oft) auch hier neben mir selbst." So begann Herta Müller ihre Tischrede nach der Verleihung des Nobelpreises. In einem langen Gespräch mit Angelika Klammer erzählt sie von ihrem ungewöhnlichen Lebensweg, der vom Kind, das Kühe hütet, bis zur weltweit bekannten Schriftstellerin im Stadthaus in Stockholm führt. Sie erzählt von der Kindheit in Rumänien, vom Erwachsenwerden und dem erwachenden politischen Bewusstsein, von den frühen Begegnungen mit der Literatur, den Konflikten mit der Diktatur des Kommunismus und dem eigenen Weg zum Schreiben. Mit ihrem Bericht vom An...
"Ich stehe (wie so oft) auch hier neben mir selbst." So begann Herta Müller ihre Tischrede nach der Verleihung des Nobelpreises. In einem langen Gespräch mit Angelika Klammer erzählt sie von ihrem ungewöhnlichen Lebensweg, der vom Kind, das Kühe hütet, bis zur weltweit bekannten Schriftstellerin im Stadthaus in Stockholm führt. Sie erzählt von der Kindheit in Rumänien, vom Erwachsenwerden und dem erwachenden politischen Bewusstsein, von den frühen Begegnungen mit der Literatur, den Konflikten mit der Diktatur des Kommunismus und dem eigenen Weg zum Schreiben. Mit ihrem Bericht vom Ankommen in einem neuen Land fällt auch ein ungewohnter Blick auf das Deutschland der 80er und 90er Jahre und auf die Gesellschaft, in der wir heute leben.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.