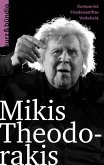»Vielleicht muss einem die Stadt, in der so viel eigene Vergangenheit hängt, ganz verloren erscheinen, um neu erblickt, neu angenommen zu werden.«
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Individuelles im Blick: Peter Gülke über seine Heimatstadt Weimar
In Deutschland, dem geographisch, politisch, kulturell so buntscheckigen, weil eng gekammerten Land, ist Weimar ein besonderer Fall. Seine Bürger haben ein ganz eigenes, persönliches, fast intimes Verhältnis zu ihrer Stadt und deren kulturgeschichtlicher Größe, auf das man in Wittenberg etwa, das doch vergleichbar sein sollte - auch darin, dass die vergangene Größe sich nicht vorrangig in Bauten oder Kunstbesitz materialisiert hat - nicht trifft.
In seinem neuen Buch "Mein Weimar" gibt Peter Gülke, der Dirigent und Musikwissenschaftler, ein Beispiel dieser Art des Denkens und Fühlens. Schon auf der ersten Seite legt er es offen: Um "mich weimarisch, als Sohn der Stadt zu definieren, schreibe ich hier - und um Dank zu sagen". Es ist ein sehr persönliches Buch geworden, darin liegt seine Stärke. Das betrifft auch, was Gülke über die DDR zu sagen hat. Viel Sympathie bringt er Partei und Staat nicht entgegen, was nicht erstaunt, 1983 war er nach einem Auftritt in Hamburg im Westen geblieben.
Er beschreibt, wie er und die anderen Studenten 1953 in der Aula der Musikhochschule die Hand zur Exmatrikulation von acht Kommilitonen hoben; noch Tage danach habe man sich "wie unter Drogen befunden", kaum miteinander sprechen können. "Später dann, nie mehr beschwichtigt, die Frage: Wer waren wir an diesem Abend? Jedenfalls nicht wir selbst. Das haben sie gekonnt." Und rund drei Jahrzehnte später eine Erfahrung, die er als Generalmusikdirektor in Weimar machte: Vor eine Aufführung der Neunten Sinfonie Beethovens hatte er Schönbergs "Ein Überlebender von Warschau" stellen wollen, die SED aber verhinderte das: "Wir sind das bessere Deutschland, wir haben das nicht nötig."
Allerdings habe sich im Willen, dem Druck von oben standzuhalten, auch eine verschwörerische Atmosphäre entwickelt; in dieser "Verschwörer-Verbundenheit" sei vieles entstanden, hervorragende Inszenierungen wie gründliche editorische Arbeiten. Und Borniertheiten findet der Autor auch im Westen, vor allem in dessen "monolithischem Bild" der DDR-Gesellschaft. Das Monolithische ist ihm in allen Zusammenhängen zuwider, er will ein Mann des individualisierenden Blickes sein.
Dieses Interesse für den einzelnen Fall ist der schönste Zug des Buches, darin liegt eine unprogrammatische Humanität. Gülke erinnert sich an ein Mädchen aus dem Kindergarten, Anneliese Mellinger, die wohl behindert war. Als 1939/40 "sachkundige Herren" kamen, um die Kinder zu inspizieren, mussten diese sich halb ausziehen, Anneliese Mellinger aber vollständig. Was ist mit ihr geschehen? Ist sie umgebracht worden? Gülke weiß es nicht, aber er erinnert sich an die Situation, die Peinlichkeit, das Mitleid, das die Kinder empfanden, das "entsetzte Gesicht der Kindergärtnerinnen".
Tiefen Eindruck muss auf ihn die Kindergärtnerin Käte Michael gemacht haben, die eine Atmosphäre von Fröhlichkeit, kindlichem Selbstvertrauen und Behauptungswillen schuf. "Dennoch, trotz aller wuseligen Lebendigkeit, kein Summerhill! Hier musste gehorcht werden (...), ein beschwingtes wie strenges Regiment." Es klingt wie der Sinnspruch des Leipziger Gewandhauses: "Res severa verum gaudium". An solchen Stellen bekommt der Leser zu fassen, was für Gülke die Eigenart Weimars ausmacht: das "existentielle, auf Identifikation drängende Verhältnis" zur Kunst. Sein Ideal ist Hermann Abendroths Arbeit mit dem Weimarer Orchester: "In Weimar gab es eine besondere, bis aufs spieltechnische Niveau durchschlagende Nähe." Das ging und geht wohl bis heute mit Konservatismus, einer gewissen Betulichkeit einher. Und es kennzeichnet Gülke, dass ihm dieser Konservatismus so bedenklich ist wie umgekehrt das aktuell sich rasch einstellende "Odium des Schon-Dagewesenen".
Aber vielleicht hat Weimars große, auch lastende Tradition mehr als nur ästhetischen Konservatismus zur Folge gehabt. Gülke beendet sein Buch mit Gedanken zum Konzentrationslager Buchenwald, ruft dabei die Klassiker zum Thema auf, sein Blickwinkel ist ein anthropologischer. Aber was, wenn nicht am KZ Buchenwald, so doch an den frühen großen Erfolgen des Nationalsozialismus in Thüringen und Weimar ortstypisch gewesen sein könnte, das wäre auch eine Überlegung wert gewesen.
STEPHAN SPEICHER
Peter Gülke: "Mein Weimar".
Insel Verlag, Berlin 2019. 176 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH