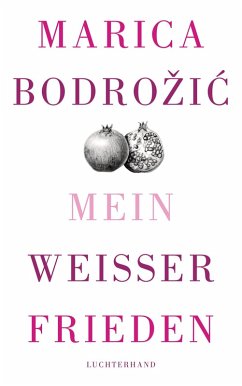Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

© BÜCHERmagazin, Melanie Schippling
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Ist eine Friedensreise auch friedenspreiswürdig? Marica Bodrozic schreibt distanzlos über den Bosnien-Krieg
Könnten Palmen einen Krieg verhindern, so müsste man sich um die südliche Hälfte der Welt keine Sorgen machen. Sie werden es wohl nie können. Aber wenn die Schriftstellerin Marica Bodrozic in der Landschaft ihrer Geburt unter einer Palme steht, kann sie es nicht glauben: "Wie kann man Menschen erschießen, während der Wind in den Palmen singt?", fragt sie sich auf der Reise entlang der Spuren der Jugoslawien-Kriege, mit Schwerpunkt auf Kroatien. Dreimal klingt diese Fassungslosigkeit an. Die Palme, das ist der Fetisch von Bodrozics Naturmystizismus. Für die Palme, diese elegante Krone der Natur, gilt, genauso wie für den Menschen, die Unschuldsvermutung - von seiner "ursprünglichen Reinheit" ist sogar die Rede. Darauf muss sich einschwingen, wer 330 Seiten Kriegs-, Gesellschafts- und Reisereflexionen durchstehen will.
Sie beginnen mit einem jener Erinnerungsbilder, für deren Aura aus Verklärung und Verletzlichkeit die Autorin geliebt wird. Nachdem der Vater dem Kind nächtelang die Sterne erklärt und als lebende Wesen nahegebracht hat, drückt er ihm, in unerklärter Widersprüchlichkeit, am Heiligabend eine Pistole in die Hand: "Es half kein Weigern und kein Weinen. Schieß den Sternen in den Bauch, sagte er und hielt meinen Körper fest, der Schuss fiel, ich zitterte am ganzen Leib. Habe ich die Sterne erschossen, fragte ich ihn, erhielt aber keine Antwort." Man kann diese unvermittelt gewaltsame Szene als prophetisches Bild lesen: als Vorbereitung auf eine Zeit, in der nicht die Beziehungen zählen, die Menschen zu dem sie umgebenden Kosmos aufgebaut haben, sondern die Befehle zu dessen Zerstörung.
So kam es. Tito starb, der jugoslawische Kosmos, dessen Gesetze für das Kind ehern schienen, zerfiel, es folgte - mehr zeitlich als kausal - mit den Jugoslawien-Kriegen der tragische Abschluss des "Jahrhunderts der Wölfe". Marica Bodrozics autobiographisch gefärbte Bücher widmen und widersetzen sich seit ihrem Debüt "Tito ist tot" dieser speziellen Art des Kindheitsverlusts. Die Autorin kam als zehnjähriges Mädchen, das zuvor in Dalmatien beim Großvater aufgewachsen war, 1983 zu den Eltern nach Deutschland. Die vormals äußere Welt fand, so lässt es sich lesen, in der inneren Welt der Vorstellung ein Exil. Dieses imaginierte Land, gleichsam eine Annäherung an einen als ursprüngliches Sehen erlebten Zustand der Kindheit, prägt sich oft als poetologischer Ausgangspunkt von Bodrozics schriftstellerischem Denken ein.
Auch in "Mein weißer Friede" gibt es wieder schöne Zeugnisse eines so gestimmten Schauens. Nicht selten ist es ein Staunen, die "über das Wissen der Haut vollzogene Erkenntnis im Alter von fünf Jahren, dass nicht meine blaue Strickjacke kleiner, sondern ich selbst größer wurde". Eine buchstäbliche Sternstunde dieses am Kindheitsblick geschulten Differenzwahrnehmens ist der Essay "Sterne erben, Sterne färben" (2007) über das Aneignen der deutschen Sprache.
"Mein weißer Friede" ist dagegen ein Unterfangen, das die kindliche Vollkommenheitssehnsucht der Autorin mehr und anders als die bisherigen Werke auf die Probe stellt. Das im Titel zugleich erklärte und verklärte Ziel lautet Aufarbeitung. Das "Erbe des Krieges", seine "dunklen Gaben, die wie eine lauernde Krankheit in den Gesichtern, Geschichten, Körpern, Sätzen und der Vorstellungskraft der Menschen weiterleben", müssen verwandelt werden in den "weißen Frieden" eines Gesprächs "mit dem inneren Selbst", den es "ohne Bewusstsein nicht geben kann". Das geschieht in 24 Episoden mit Eindrücken von Reisen nach Split, Sarajewo, Mostar, zu den dalmatischen Kindheitsorten, in die Krajina, auf die kroatischen Inseln oder ins amerikanische Dayton.
Die Hauptschwierigkeit dieser Bewusstseinsreisen liegt darin, dass ihr Inhalt, anders als die äußeren Entfernungen, nahezu unendlich ist. Welche Fragen des zwanzigsten Jahrhunderts müssen wiederholt werden, welche neu gestellt? Mit welchen Denkern lässt sich das Umschlagen von Zivilisation in Barbarei begreifen, und wie lässt sich eine entsprechende Realität literarisch rekonstruieren? Und weiter die spezifischeren Fragen: nach der Selbstfindung posttotalitärer Staaten in einem nationalstaatlich geprägten Europa etwa oder der empfindlichen Nähe von Nationalismus und Faschismus.
Dafür befragt Marica Bodrozic etwa zwei Dutzend Denker und Autoren. Die Selbstverantwortung einer Sophie Scholl wird ebenso angeführt wie Hannah Arendts Einschätzung von der "Oberflächlichkeit des Bösen" oder etwa Dzevad Karahasans Vergleich zwischen industrieller Serienproduktion und vereinheitlichendem Nationalismus. Der Versuch, ein zivilisatorisches Rezept gegen den Krieg zu finden, muss sich jedoch als unhaltbar romantisch herausstellen. Gerade die Jugoslawien-Kriege im Post-Holocaust-Europa haben gezeigt, dass Frieden heute weniger eine zivilisatorische Errungenschaft als in erster Linie eine politische ist. Das gilt seit Anbruch der digitalen Zeitrechnung umso mehr. Politische Analysen aber liefert Marica Bodrozic genauso wenig, wie sie sich zu einer literarischen Transzendenz freischreiben kann.
Es ist nicht leicht, ihr auf die Reise zu folgen. Widerstände bauen zudem die häufigen Generalisierungen bis hin zu Spekulationen auf. Die Natur scheint gut, die Menschenmasse schlecht, ein Mann gerät allein ob seines Stotterns in den Verdacht, eine Kriegsschuld auf sich geladen zu haben. Solche Undifferenziertheiten des Denkens ecken zuweilen auch sprachbildlich an. Über den kroatischen Kriegszeitpräsidenten Tudjman heißt es einmal, er sei, "aus der Distanz betrachtet, ein lispelnder Mensch" gewesen. Das klingt, als würde die Autorin die Weltgeschichte durchs Opernglas verfolgen.
Sie stößt jedoch nicht nur beim Versuch eines einordnenden Begreifens an Grenzen. Auch die biographisch-dokumentarische Annäherung an ihr Sujet verhindert den Zugang teilweise mehr, als dass sie ihn fördert. Nicht nur die zeitliche Nähe zum Geschehen, sondern auch die Nähe zum Gegenüber sind für eine sachliche Auseinandersetzung eher von Nachteil. Viel transportieren die Gespräche bei Feigen und türkischem Kaffee jedenfalls nicht. "Jeder trägt seinen Teil der Erinnerung, so gut er kann", wird einmal in Mathias Enards Kriegsepos "Zone" behauptet. Davon lässt sich die Friedensreisende Bodrozic zu schnell und zu widerstandslos überzeugen. Ihr bleibt am Ende nur die Predigt.
ASTRID KAMINSKI
Marica Bodrozic: "Mein weißer Frieden".
Luchterhand Verlag, München 2014. 336 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main