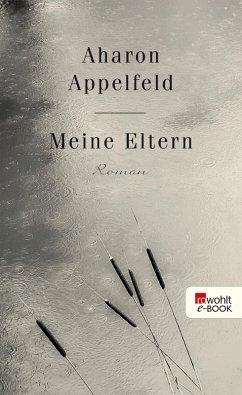Familienbild vor der Katastrophe: Aharon Appelfelds Roman über den letzten Sommer einer Kindheit August 1938: Am Ufer des Flusses Prut in Rumänien versammeln sich die Sommerfrischler, überwiegend säkularisierte Juden, darunter ein Schriftsteller, eine Wahrsagerin, eine früher mit einem Christen liierte Frau, die nun auf Männerschau ist. Auch der zehnjährige Erwin und seine Eltern sind hier, doch das Kind spürt, dass etwas anders ist: Hinter den Sommerfreuden, den Badeausflügen und Liebeleien geht die Welt, die alle kennen, zu Ende. Einige reisen früher ab, andere verdrängen die Nachrichten aus dem Westen. Spannungen bleiben nicht aus, auch nicht zwischen den Eltern, der Mutter, die Romane liest, an Gott glaubt und an das Gute, und dem Vater, dem Ingenieur, der alles rational und pessimistisch sieht. Als die Familie in die Stadt aufbricht, überfällt Erwin die Furcht. In der Schule wurde er geschlagen und als «Saujude» beschimpft - und er beginnt zu ahnen, dass an den unterschiedlichen Haltungen seiner Eltern noch viel mehr hängt: die Zukunft, das Überleben. Ein feinfühliger Roman, der seismographisch die Brutalität des heraufziehenden Krieges verzeichnet - und zugleich das Porträt einer bürgerlichen Welt vor der Katastrophe. Eines der persönlichsten Bücher von Aharon Appelfeld, direkt, ehrlich und doch auch kindlich-schön.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.