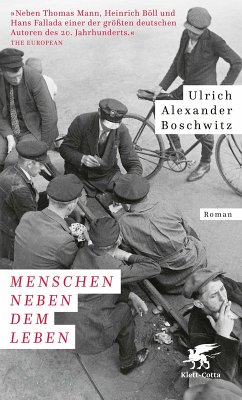Eine junge Frau, offenbar selbstmordgefährdet, steht auf einem Dach und die ganze Kleinstadt gerät in Aufruhr. Wird sie springen oder nicht?
In „Der Sprung“ steht jedoch nicht die junge Frau, die vermutlich vom Dach springen will, im Mittelpunkt, sondern elf Menschen aus deren mittel- und
unmittelbarem Umfeld. Ob das ältliche Pärchen Theres und Walther, welches um die Ecke der Geschehnisse ein…mehrEine junge Frau, offenbar selbstmordgefährdet, steht auf einem Dach und die ganze Kleinstadt gerät in Aufruhr. Wird sie springen oder nicht?
In „Der Sprung“ steht jedoch nicht die junge Frau, die vermutlich vom Dach springen will, im Mittelpunkt, sondern elf Menschen aus deren mittel- und unmittelbarem Umfeld. Ob das ältliche Pärchen Theres und Walther, welches um die Ecke der Geschehnisse ein kleines Lebensmittelgeschäft betreiben, der Polizist, der mit aller Anstrengung versucht, die junge Frau zu überzeugen, nicht zu springen, oder der Freund der zunächst unbekannten Frau: Die Leben aller elf Personen in dem Roman sind von den Taten betroffen.
Die kurzen Abschnitte, in denen die Geschehnisse des Tages aus der Sicht der jeweiligen Person geschildert werden, machen deutlich, wie sehr das Leben eines jeden Menschen aus unzähligen Verknüpfungen zu anderen Personen besteht. Große (oder auch kleine) Taten und tragische Ereignisse haben Auswirkungen auf unsere Umgebung – direkte und indirekte, negative und zum Teil sogar positive Effekte.
Zu Beginn des Romans fällt es zunächst schwer, den Überblick über die einzelnen Personen zu behalten. Ich musste öfters zurückblättern, um mir wieder in Erinnerung zu rufen, in welcher Beziehung (oder auch nicht) die Person nun zu den vorherigen steht. Dadurch jedoch, dass die einzelnen Abschnitte teilweise erstaunlich stark in die Tiefe gehen und man trotz der wenigen Seiten sehr viel von den Lebensgeschichten der einzelnen Protagonisten erfährt, ist man sehr schnell in der Geschichte drin. Es ist es faszinierend und zeugt von großem literarischen Talent, dass es der Autorin gelingt, auf nur 300 Seiten die Lebensgeschichten von elf Personen zu skizzieren und miteinander zu verknüpfen: Während zu Beginn die beschriebenen Personen für sich allein stehen, entsteht im Verlauf der Geschichte ein Netz, welches die Schicksale miteinander verknüpft.
Simone Lapperts Schreibstil ist angenehm leicht, ohne dabei in irgendeiner Art und Weise oberflächlich zu sein. Ihre Figuren sind teilweise ein bisschen verrückt, gemein, liebevoll, untreu – und damit eben sehr realistisch gestaltet. Obwohl das Springen der Frau im Prequel der eigentlichen Geschichte bereits angedeutet wird – es beschreibt den Tritt über den Abgrund und das anschließende Fallen – bleibt die Geschichte spannend. Vor allem die dem Leser lange Zeit verborgene Identität ist ein literarisch kluger Schachzug. Das Ende empfinde ich als gelungen und ebenfalls sehr realitätsnah.