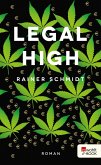Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Was macht man sich nur aus diesem höchst rätselhaften Text? Georg Kleins "Miakro" ist ein phantastisch ekelhafter Büro-Roman.
Von Jan Wiele
Wenn man Literatur als Kunstform ernst nimmt, muss es auch einmal erlaubt sein zuzugeben, dass man über einen Text noch ein sehr vorläufiges Urteil hat. Nach Erstlektüre von Georg Kleins angeblichem Roman "Miakro" ist es gut möglich, dass einem Leser noch völlig unklar ist, ob er davon begeistert, genervt oder angeekelt sein soll - vielleicht ist auch alles zusammen denkbar.
Dass das Buch Ekel erzeugen soll, wer wollte es nach dem folgenden Auszug bezweifeln? "Wir haben dir die Kartoffeln zu Brei zerdrückt, aber was davon in dich hineingegabelt wurde, hast du gleich wieder hochgewürgt. Nur die durchgekauten Dicksprossen, die sie uns für dich mitgegeben hat, sind in dir dringeblieben. Du hast dich fünf Tage lang von Wasser, Sprossenbrei und Weiberspucke ernährt."
Diese Auskunft erhält ein Arbeiter von seinen Kollegen, die ihn nach seiner fiebrigen Erkrankung wieder aufgepäppelt haben. Ist das also ein realistisches Setting? Eine Sozialreportage? Kaum. Aus dem Zitat kann man Interessantes über Georg Kleins literarische Technik ableiten: Abgesehen von den "Dicksprossen", die man vielleicht nicht kennt, aber sich doch sofort etwas darunter vorstellen kann, benutzt er zumeist durchaus geläufige, vertraute Sprache. In der Welt seiner Erzählung gibt es Menschen und Tiere, Männer und Frauen, es gibt Jahreszeiten und die Empfindung von Schmerz. Aber so scheinbar vertraut die Sprachelemente zunächst klingen - das, wozu Klein sie dann zusammensetzt, ist doch etwas völlig Fremdes, teils Unerhörtes: "Zinkenspitzen", "Grundgepünktel", "Rübenheldgepurzel".
Die Arbeiter in diesem Roman plagen sich in einem "Büro" - der Begriff fällt schon auf den ersten Seiten und dann immer wieder. Damit steht der Text in einer literarischen Tradition, nämlich der des Angestelltenromans. Man denkt etwa an Robert Walsers "Der Gehülfe" (1908), natürlich an Kafka, vielleicht auch an Wilhelm Genazino. Das Thema der Entfremdung, des Ausgeliefertseins an höhere, unverständliche Mächte ist damit von Beginn an gesetzt, aber Georg Klein gibt ihm auch sofort noch einen Dreh ins Phantastische: Das besagte Büro ist ein seltsam flexibler, unüberschaubarer Bau, in dem ständig neue Flure entstehen und andere wieder verschwinden. Das Phantastische überrascht den Leser in behutsam eingestreuten Neologismen, zum Beispiel in den für den Roman zentralen Verben "auswanden" und "einwanden".
Dazu muss man sich vorstellen, dass die Wände des besagten Büros nicht hart, sondern elastisch sind, vielleicht gar Teile eines organischen Wesens. Ausgewandet, also hervorgebracht, werden Arbeitsgegenstände und Lebensmittel - in sogenannten Nährfluren formt die Wand auch schon mal Nippel, die Flüssigkeit verspritzen. Lebensweltliche Parallelen etwa zu 3D-Druckern und künstlich gezüchtetem Fleisch scheinen hier auf. Eingewandet, also verschluckt werden abgenutzte Geräte, aber auch Menschen: Da verstirbt einmal ein Arbeiter, und am folgenden Morgen ist er bereits "spaltlos eingewandet". Frei nach der Horrorerkenntnis "Soylent Green is People!" darf man auch hier einen Zusammenhang zwischen den eingewandeten Toten und der ausgewandeten Speise vermuten, die oft aus Pudding oder "Tunke" besteht.
Langsam begreift man, dass das Büro eine "Innenwelt" bildet, während draußen, hinter der Wand, die "wilde Welt" liegt - hier verknüpft Klein alte Science-Fiction-Topoi mit Platons Höhlengleichnis. Die Innenweltler verrichten sogenannte Glasarbeit, bei der sie einen "Bildfluss" in Gang halten müssen, sie führen eine regredierte Sekundärexistenz, die Klein uns teils aus ihrer Perspektive schildert. Dann plötzlich wechselt die Erzählung nach außen in die märchenhafte Wildwelt, in der es "Bitterseen", Riesenpilze und ein "Mordmückenrayon" gibt. Eine Naturkontrollagentin namens Xazy soll mit einem Erkundungstrupp ein großes "Unding" untersuchen, von dem man annimmt, dass es der besagte Büro-Organismus ist. Bewohner beider Ebenen nähern sich an, es sammelt sich in widerlichen Wurmszenen langsam der Alien-Genremüll, und Frau Xazy lernt schließlich die Glasarbeit.
Trotz alledem kann Kleins Prosa durchaus amüsant sein, weil sie so sprachschöpferisch ist - manchmal könnte man glauben, im Sinne einer deutschen Sprachakademie. Ist "Gegenspruchbeule" vielleicht nur ein schöneres Wort für "Handy" und "Glastiefenschleim" eines für allen Rotz im Internet?
Wofür diese gefühlte Allegorie, deren Titel Mikro- und Makroebene vereint, eigentlich steht, bleibt äußerst fraglich. Handelt es sich am Ende um einen weiteren Google-Roman oder um fiktionalisierte Sprachkritik? Ist es einfach nur ein mit expressionistischen Mitteln übersteigerter Kantinenbesuch, oder, ganz steile These, eine Parodie der Pläne für das Humboldt Forum? Kaum eine Deutung, die sich nicht irgendwie plausibel machen ließe - und dann auch manchmal die Ahnung, dass Georg Klein nur spielen will: Eines der kurzen Kapitel trägt die Überschrift "Denkverhinderung - Was so gut wie nichts bedeuten könnte".
Georg Klein: "Miakro".
Roman.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2018. 334 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH