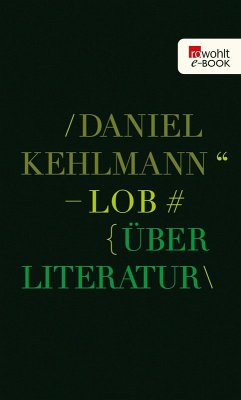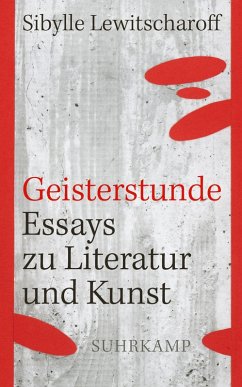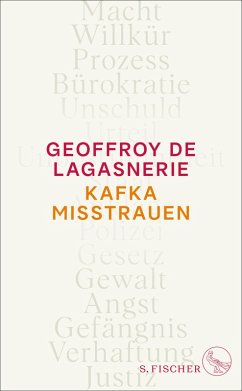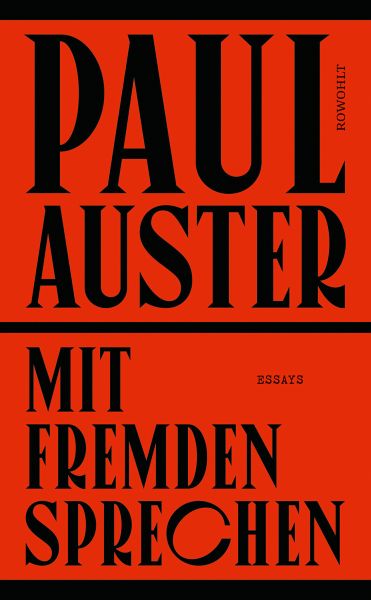
Mit Fremden sprechen (eBook, ePUB)
Ausgewählte Essays und andere Schriften aus 50 Jahren
Übersetzer: Schmitz, Werner; Pechmann, Alexander; Habeck, Robert; Paluch, Andrea; Sattler Charnitzky, Marion
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
14,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Mit Fremden sprechen" ist eine vom Autor selbst zusammengestellte Auswahl seiner besten Essays und Schriften aus fünfzig Jahren, die sowohl berühmte Texte als auch bislang Unveröffentlichtes enthält. Beginnend mit einer kurzen philosophischen Betrachtung, die er mit zwanzig schrieb, und schließend mit einer Reihe von politischen Texten über Themen wie Obdachlosigkeit, 9/11 oder den Zusammenhang zwischen Fußball und Krieg, bieten die 44 Stücke dieser Auswahl einen großen Überblick über Austers Ansichten zu klassischen und zeitgenössischen Schriftstellern, zur Hochseilartistik von P...
"Mit Fremden sprechen" ist eine vom Autor selbst zusammengestellte Auswahl seiner besten Essays und Schriften aus fünfzig Jahren, die sowohl berühmte Texte als auch bislang Unveröffentlichtes enthält. Beginnend mit einer kurzen philosophischen Betrachtung, die er mit zwanzig schrieb, und schließend mit einer Reihe von politischen Texten über Themen wie Obdachlosigkeit, 9/11 oder den Zusammenhang zwischen Fußball und Krieg, bieten die 44 Stücke dieser Auswahl einen großen Überblick über Austers Ansichten zu klassischen und zeitgenössischen Schriftstellern, zur Hochseilartistik von Philippe Petit, zu seinen Kunstaktionen mit Sophie Calle und dem langen Weg, den er mit seiner geliebten mechanischen Schreibmaschine zurückgelegt hat. Ebenfalls enthalten sind jüngere Texte über die Notizbücher von Nathaniel Hawthorne, die Filme von Jim Jarmusch, eine Vorlesung zu Edgar Allen Poe, eine Tirade gegen den ehemaligen New Yorker Bürgermeister und Trump-Gehilfen Rudy Giuliani sowie die lustigste Einführung zu einer Dichterlesung, die in Amerika je gehalten wurde.. Hochintelligent und zutiefst menschlich - eine unverzichtbare Kollektion für alle Leser und Fans des "angesehensten amerikanischen Schriftstellers seiner Generation". (The Spectator)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.