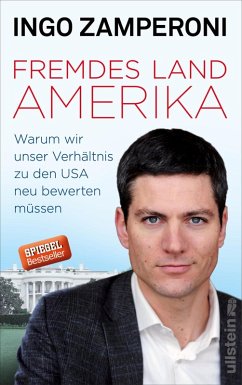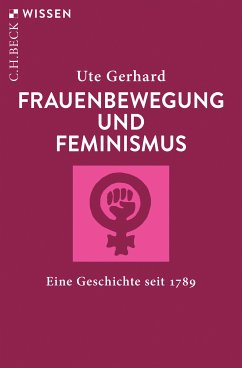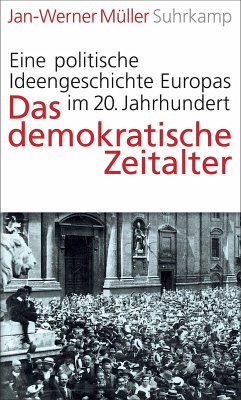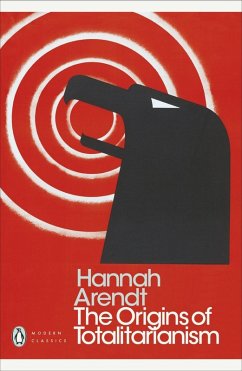Mitte und Maß (eBook, ePUB)
Der Kampf um die richtige Ordnung

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Muss man die Mitte besetzen, um die Macht zu sichern? Oder ist sie eher der Ort, an dem die größte Gefahr droht, nämlich von allen Seiten? Behindert eine starke Mitte den Fortschritt der Geschichte? Was genau bedeutet «Mitte» überhaupt? Warum ist sie zum politischen Schlüsselbegriff geworden? Und inwiefern hängt sie mit der Tugend des Maßhaltens zusammen? Herfried Münkler zeigt, wie sich die Ideen von Mitte und Maß gemeinsam entwickelten, von der Antike bis in die Gegenwart: von Aristoteles bis zur Gierdebatte unserer Tage, vom Selbstverständnis Chinas als «Reich der Mitte» bis z...
Muss man die Mitte besetzen, um die Macht zu sichern? Oder ist sie eher der Ort, an dem die größte Gefahr droht, nämlich von allen Seiten? Behindert eine starke Mitte den Fortschritt der Geschichte? Was genau bedeutet «Mitte» überhaupt? Warum ist sie zum politischen Schlüsselbegriff geworden? Und inwiefern hängt sie mit der Tugend des Maßhaltens zusammen? Herfried Münkler zeigt, wie sich die Ideen von Mitte und Maß gemeinsam entwickelten, von der Antike bis in die Gegenwart: von Aristoteles bis zur Gierdebatte unserer Tage, vom Selbstverständnis Chinas als «Reich der Mitte» bis zum Deutschen Reich als «Mittelmacht», von der mittelalterlichen Stadt, deren Mitte durch Kirchturm und Rathaus markiert wird, bis zur schrumpfenden Mittelschicht in den Gesellschaften des 21. Jahrhunderts. So entsteht ein facettenreiches Bild jener Verbindung von Mitte und Maß, die unsere Kultur auf so besondere Weise durchdringt. Die Frage, die gleichsam Fluchtpunkt aller Überlegungen ist, beunruhigt: Wird die «Mitte der Gesellschaft» deshalb so lebhaft beschworen, weil sie in Gefahr ist zu verschwinden? Und falls ja - was tritt an ihre Stelle? Ein Buch, das historische Analyse, Gegenwartsdiagnose und Zukunftsprognose souverän verbindet.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.