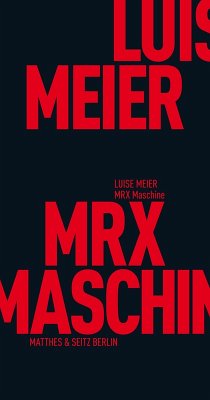Zu seinem 200. Geburtstag ist Karl Marx so tot wie lange nicht: Entweder wird er für triviale Niedergangspredigten in Anspruch genommen oder zur Erstellung neuer Theorien ausgeschlachtet, um den akademischen Markt mit frischen Waren zu versorgen. Es ist Zeit, Marx als Zündschnur zu gebrauchen. So entsteht die MRX-Maschine. Die MRX-Maschine zapft Feminismus, Postkolonialismus und anderes an und sucht nach den Rissen, der Perversion und dem Gestank, die das Proletariat hinter dem unternehmerischen Selbst erkennbar machen. Die MRX-Maschine scannt die Schauplätze der öffentlichen Selbstvermarktung und die private Fabrik der Körperoptimierung nach Spuren des internalisierten Klassenkampfs, der nach Desintegration und Verschwendung schreit, und zerkratzt dabei die polierte Benutzeroberfläche. MRX-Maschine ist ein geheimer Gruß an alle Verweigerer und Blaumacher, sie ist Analyse Agitation und Aggression in einem - und für die Zeit der Lektüre sind Sie krankgeschrieben.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.