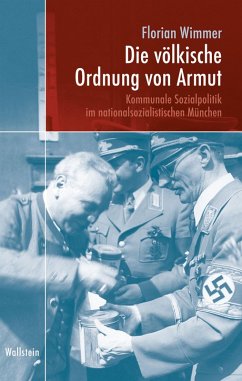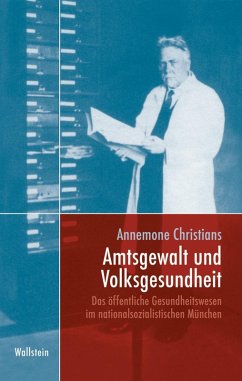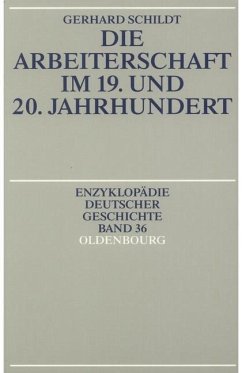München und sein Stadtbürgertum (eBook, PDF)
Eine Residenzstadt als Bürgergemeinde 1780-1870
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
109,95 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
München im 19. Jahrhundert: Stadt des Hofes und des Adels, der Universität und der Akademien, der Künstler, Beamten, Diplomaten und Offiziere, der Professoren und der Geistlichen. Wie behauptete sich unter diesen Umständen das Stadtbürgertum: die Bankiers, die Kaufleute, die Fabrikanten und die Handwerksmeister? Und wie behauptete sich die Stadtgemeinde mit ihren gewählten Repräsentanten gegenüber Staatsverwaltung und Königsherrschaft? Ralf Zerbacks Studie greift ins 18.Jahrhundert zurück und zeichnet nach, wie das städtische Bürgertum auch unter erschwerten Bedingungen seinen Weg ...
München im 19. Jahrhundert: Stadt des Hofes und des Adels, der Universität und der Akademien, der Künstler, Beamten, Diplomaten und Offiziere, der Professoren und der Geistlichen. Wie behauptete sich unter diesen Umständen das Stadtbürgertum: die Bankiers, die Kaufleute, die Fabrikanten und die Handwerksmeister? Und wie behauptete sich die Stadtgemeinde mit ihren gewählten Repräsentanten gegenüber Staatsverwaltung und Königsherrschaft? Ralf Zerbacks Studie greift ins 18.Jahrhundert zurück und zeichnet nach, wie das städtische Bürgertum auch unter erschwerten Bedingungen seinen Weg in die moderne Gesellschaft des 19. Jahrhunderts fand. Als einziger gesellschaftlicher Kraft gelang es ihm, von einer Traditionsbasis aus moderne Anliegen zu formulieren. Wie sich dies im einzelnen ausnahm, wird an den Beispielen der politischen Interessenwahrnehmung, der gesellschaftlichen Zusammenschlüsse, der wirtschaftlichen Entwicklung und der sozialen Initiativen gezeigt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.