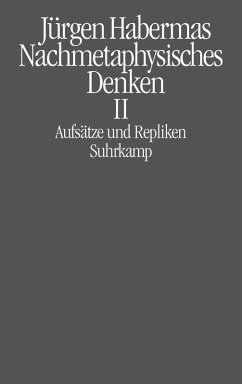»Wir haben zum nachmetaphysischen Denken keine Alternative.« Dieser Satz, geschrieben von Jürgen Habermas in seiner 1988 erschienenen Aufsatzsammlung Nachmetaphysisches Denken, gilt noch heute. »Nachmetaphysisches Denken« - das ist zunächst die historische Antwort auf die Krise der Metaphysik nach Hegel, deren zentrale Denkfiguren vor allem durch gesellschaftliche, aber auch innerwissenschaftliche Entwicklungen ins Wanken geraten sind. In der Folge wurden das Erkenntnisprivileg der Philosophie erschüttert, ihre Grundbegriffe detranszendentalisiert und der Vorrang der Theorie vor der Praxis in Frage gestellt. Aus guten Gründen hat die philosophische Theorie, so die Diagnose damals, »ihren außeralltäglichen Status eingebüßt«, sich damit aber auch neue Probleme eingehandelt. In »Nachmetaphysisches Denken II« widmet sich Habermas einigen dieser Probleme in zum Teil bisher unveröffentlichten Texten. Im ersten Teil des Buches geht es um den Perspektivenwechsel von metaphysischen Weltbildern zur Lebenswelt. Letztere analysiert Habermas als »Raum der Gründe« - auch dort, wo die Sprache (noch) nicht regiert, etwa in der gestischen Kommunikation und im Ritus. Im zweiten Teil steht das spannungsreiche Verhältnis von Religion und nachmetaphysischem Denken im Vordergrund. Habermas schließt hier unmittelbar an seine weitsichtige Bemerkung von 1988 an, wonach die »Philosophie auch in ihrer nachmetaphysischen Gestalt Religion weder ersetzen noch verdrängen« kann, und erkundet etwa das neue Interesse der Philosophie an der Religion. Den Abschluss bilden Texte über die Rolle der Religion im politischen Kontext einer postsäkularen, liberalen Gesellschaft.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.