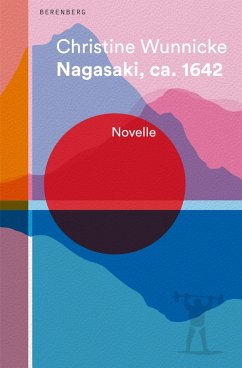Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Doppelt erzählt hält besser: Christine Wunnickes neuer Roman "Die Dame mit der bemalten Hand" setzt ihre Reihe von Vergangenheitsfiktionen aufs schönste, klügste und witzigste fort. Und für Shakespeare-Freunde steckt auch noch etwas drin.
Der Berenberg Verlag muss etwas geahnt haben. Im Frühjahr wurde, als wäre es ein Hors d'oeuvre, Christine Wunnickes vor zehn Jahren in der mittlerweile untergegangenen Edition Epoca publizierte Novelle "Nagasaki, ca. 1642" wiederaufgelegt. Das eigentliche Festmenü aber hat uns Wunnicke erst jetzt beschert: mit ihrem neuen Roman "Die Dame mit der bemalten Hand", der sich seit gestern auf der Shortlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises befindet. Das sollte der 1966 geborenen Münchner Autorin, die schon seit mehr als zwanzig Jahren im Geschäft ist, endlich den verdienten Durchbruch beim großen Publikum bescheren, nachdem sie seit vielen Jahren ein Liebling der Kritik ist und mit dem Literaturpreis der Landeshauptstadt München kürzlich auch die erste bedeutende Auszeichnung erhalten hat. Da ihre Bücher allesamt kurz sind, freut man sich, zwei auf einmal lesen zu können. Und noch dazu zwei so thematisch wahlverwandte.
Der Titel der wiederaufgelegten Novelle ist bezeichnend für Wunnickes Literaturverständnis: Das "ca." ist paradox bei einer fiktiven Geschichte, die die Autorin doch nach Gutdünken gestalten, also auch mit einer eindeutigen Handlungszeit versehen kann. Aber das Unbestimmte, Zeitlose ihrer historischen Stoffe ist deren Charakteristikum, und so ist die Geschichte des auf seinen Karrierehöhepunkt zusteuernden Samurai Seki Keijiro, der in Nagasaki auf den jungen Abel van Rheenen trifft, welcher als Dolmetscher in die niederländische Handelsniederlassung auf der künstlichen Insel Dejima gekommen ist, eine Parabel nicht nur aufs familiäre und gesellschaftliche Leben, sondern auch eine über das Missverstehen der Kulturen an der sprachlichen Oberfläche, das aber in ein viel tieferes Verständnis münden kann, wenn man überhaupt beginnt, miteinander zu sprechen. Und all das bildet auch wieder den Kern der Handlung von "Die Dame mit der bemalten Hand".
Darin sind wir ein Jahrhundert weiter und ein paar tausend Kilometer näher an Europa. Exotisch aber ist auch dieses Setting allemal. Wieder ist ein junger Mann ausgeschickt worden: Carsten Niebuhr, und zwar als "Mathematicus", sprich Kartograph, einer von einem Göttinger Orientalisten angeregten und vom dänischen König finanzierten Forschungsreise nach Arabien, von der sich der Gelehrte reichen wissenschaftlichen und der Monarch reichen finanziellen Ertrag versprach. Beide werden enttäuscht, denn außer Niebuhr kehrt keiner der anderen fünf Expeditionsteilnehmer zurück. So weit, so wahr.
Wunnicke vernebelt aber einmal mehr geschickt die historischen Fakten in ihrem Roman. Ihr Niebuhr ist ein Jahr später geboren als der echte, doch die Reise geht dafür ein Jahr früher los. Und die führt den zur Haupthandlungszeit dreißigjährigen Deutschen nicht nur bis nach Persien wie in der Wirklichkeit, sondern weit darüber hinaus (über Persien wie die Wirklichkeit), bis nach Indien nämlich, auf eine kleine Flussinsel nahe der Metropole Bombay: Gharapuri, von den Europäern Elephanta genannt nach der Steinskulptur eines Elefanten, die sich heute im Britischen Museum befindet. Auf Gharapuri geblieben aber sind bis heute zahlreiche Darstellungen der hinduistischen Götterwelt, die aus den Wänden eines ausgebauten Höhlensystems herausgemeißelt wurden. Seit 1997 ist die Insel deshalb Weltkulturerbe.
Für Niebuhr und mehr noch den Mann, den er auf Gharapuri trifft, den persischstämmigen Astronomen Musa al-Lahuri, sind die vom Zahn der Zeit angenagten Skulpturen indes weniger künftiges Weltkulturerbe als Weltalbträume. Weder der Christ noch der Muslim können mit diesen Gestaltwandlergöttern und ihrer hochsexualisierten Codierung allzu viel anfangen, wobei Musa immerhin eine Erklärung für das Unerklärliche der indischen Darstellungen hat: "Sie bedecken die Flächen mit Chaos, damit man die Geometrie ihres Bauwerks nicht sieht."
Musa ist ein rationaler Geist - wie auch nicht bei seiner Profession? Er baut die besten Astrolabien des Subkontinents, und auf der Pilgerfahrt nach Mekka hat er noch einen Seitenabstecher zu einem ignoranten Kunden gemacht und ist danach auf Gharapuri hängengeblieben, weil er sich um den dort fieberkrank liegenden Deutschen gekümmert hat. Das triste Eiland fährt kein Boot mehr an. Neben den beiden Männern gibt es auf der Insel nur noch Malik, Musas jungen persischen Gehilfen und künftigen Schwiegersohn, sowie eine indische Bettlerkolonie.
Eine Multikulti-Truppe also, die sich viel zu sagen hätte, wenn sie über eine gemeinsame Sprache verfügte. Das aber tun nur Musa und Niebuhr. Ersterer ist ein polyglotter Tausendsassa, dem bisweilen das gestelzte Sanskrit den Wortsinn verdunkelt, doch Letzterer beherrscht genug Arabisch, um sich mit ihm zu unterhalten. Dabei gelingt es Wunnicke großartig, Niebuhrs Versuch der wörtlichen Übertragung von deutschen Begriffen ins Arabische anschaulich zu machen: Das Märchen vom "Tischlein deck dich" wird zum "Deck dich selbst, oh kleiner Tisch des Wunders", die Wendung "Maulaffen feilhalten" zu "Affen des Mundes zu Markte tragen", oder jemand "lügt wie gestempelt". Die Missverständnisse und Mischverhältnisse zwischen Kulturen finden in den Gesprächen von Musa und Niebuhr schönsten, auch witzigsten Ausdruck, und die wechelseitige Fassungslosigkeit über das ihnen jeweils am anderen so Irritierende wird doch immer wieder gemildert durch das für die beiden ganz Fremde um sie herum: Indien.
Verständigung erfolgt über den Nachthimmel, vor allem das Sternbild Kassiopeia, das im arabischen Verständnis nur Teil einer viel größeren Konstellation ist, die die Bezeichnung "Dame mit der bemalten Hand" trägt. Das kleinere Bild im größeren (und umgekehrt) findet bei Wunnicke seine höchst irdische Entsprechung in Musas Familienkonstellation mit zwei Frauen und einem ganzen Schock Kinder, von dem ihm das liebste die Tochter Nayyirah ist, die ihren großen Auftritt im fast zwanzig Jahre später angesiedelten Schlusskapitel bekommt, und zwar buchstäblich als Dame mit (henna-)bemalter Hand. Alles ist in diesem Roman mit allem verknüpft: die Götter- mit der Menschenwelt, der Himmel mit der Erde, Orient und Okzident, aber mit der Intelligenz von Shakespeares "Sturm", der sich die Grundkonstellation verdankt, wie im Finale noch einmal deutlich gemacht wird, schwebt auch alles im Imaginären - dem Proprium des Romans.
War alles doch nur ein Fieberbild, geträumt irgendwo in Persien? Eine Bemerkung Niebuhrs nach der Rückkehr legt es nahe. Auch Malik, so lernen wir gegen Ende von Musa, war gar nicht mit ihm auf Gharapuri. Als Niebuhrs Reiseaufzeichnungen in französischer Sprache ihren Weg nach Indien finden, nennt Musa sie das dümmste Buch der Welt, aber er selbst erzählt Nayyirah von dem gemeinsamen Inselabenteuer. "Ihr lügt!", rügt die Tochter den Vater und fordert doch sofort: "Erzählt! Wie ging das zu?" Wir können nie genug erzählt bekommen, aber zwei Bücher von Christine Wunnicke sind schon mal ein Festschmaus. Nun bitte noch als Digestif den Buchpreis für das eine davon.
ANDREAS PLATTHAUS
Christine Wunnicke: "Nagasaki, ca. 1642". Novelle.
Berenberg Verlag, Berlin 2020. 112 S., br., 14,- [Euro].
Christine Wunnicke: "Die Dame mit der bemalten Hand". Roman.
Berenberg Verlag, Berlin 2020. 168 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main