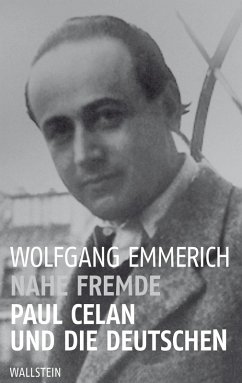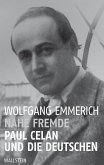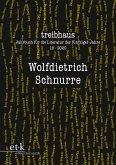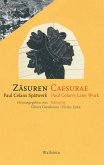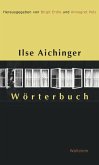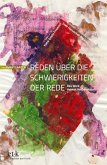Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Wolfgang Emmerich analysiert die Enttäuschung des Dichters über deutsches Unverständnis
Wolfgang Emmerich, emeritierter Professor für deutsche Literaturgeschichte und Kulturwissenschaft an der Universität Bremen, erzählt eine Geschichte, die nicht unbekannt ist: Der Dichter Paul Antschel aus der Bukowina, von jüdischer Herkunft und mit deutscher Muttersprache, überlebt den Judenmord, dem seine Eltern zum Opfer fallen. Über Bukarest, wo aus Antschel Ancel wird, geht er 1948 über Wien nach Paris, wo er sich fortan Celan nennt und den Rest seines Lebens bis zum Freitod 1970 verbringen wird.
Emmerich konzentriert sich in seiner Erzählung dieser Geschichte auf das Verhältnis zwischen dem Dichter und "den Deutschen". Die große Stärke des Buchs liegt trotz der Pauschalität im Titel gerade in der Differenziertheit, mit der Emmerich dieses Verhältnis schildert. "Die Deutschen" gibt es natürlich erst einmal nicht, sondern nur vielschichtige Einzelne, die mit Celan im Kontakt sind. Nicht einmal die Gruppe der "rheinischen Freunde", zu der in der Celan-Forschung Heinrich Böll, Paul Schallück und Rolf Schroers zusammengezogen werden, bleiben als Trio bestehen, sondern jede einzelne Beziehung wird genau dargestellt. Gleichwohl existieren Elemente in den Beziehungen zwischen Celan und diesen Einzelnen, die stärker sind als der jeweils konkrete Kontakt und die zum Kollektiven treiben. Das ist sozusagen vorgegeben, denn es gab ja ein unaustilgbares Urverbrechen, das dieses Muster vorstanzt: Wie die Mörder von Celans Eltern hießen, weiß man nicht, dass sie im Auftrag Deutschlands handelten und Deutsche waren, aber sehr wohl.
Emmerich zeigt auf, wie je unterschiedlich Celan seine Kontakte gestaltete. Seine Reaktionsmuster waren nämlich sehr verschieden, je nach Konstellation und Zeitpunkt. Erst allmählich formierte sich das Kollektiv der Deutschen im Kopf Celans, und der Autor schildert eine Reihe von Ereignissen, die diesen Prozess in Gang hielten oder sogar beschleunigten - vor allem die nicht glückenden oder gar scheiternden Freundschaften gehören dazu. Emmerich ist dabei immer sehr bemüht, die Entfremdungsprozesse möglichst multiperspektivisch auszuleuchten - ob im Falle von Hanne und Hermann Lenz, von Rolf Schroers und Ingeborg Bachmann oder von Heinrich Böll und Günter Grass. Er rechnet nicht mit Celans "nahen Fremden" ab, verdeutlicht aber, wie stark die unterschiedlichen Erfahrungen dem Gelingen jeweils im Wege standen.
Insbesondere die nichtjüdischen deutschen Freunde konnten die substantielle Beschädigung Celans und sein stetig wachsendes Misstrauen nicht verstehen. Den "enttäuschten Hitlerjungen" und ehemaligen Wehrmachtssoldaten, die nun antifaschistische Sozialdemokraten waren, fehlte die Sensibilität für das jüdische Los. Auf Celans Seite wichen hohe Erwartungen fast immer hehren Enttäuschungen über die "Linksnibelungen". Von den Niederschlägen, die Celan von den "Rechtsnibelungen", also den konservativen Kulturverwesern mit Nazi-Vergangenheit, erhielt, nicht zu sprechen. Dann wurde er sarkastisch, zum Beispiel, wenn er sich dem Kollektiv der "Krummnasigen" zurechnete, um die antisemitische Diffamierung und Ausgrenzung zu spiegeln.
Die zweite und noch erschütterndere Destruktivkraft, die Emmerich vorführt, bestand aus den öffentlichen Verleumdungen, denen Celan ausgesetzt war, oft mit antisemitischen Untertönen, allen voran die Infamie von Claire Goll. Aber auch die Reaktionen auf die Gedichte waren nicht frei davon. Die "Todesfuge" (von 1945) war zwar ein großer Erfolg, aber aus falschen Gründen, denn sie wurde in den Fünfzigern als ästhetisch schönes Gedicht "lesebuchreif gedroschen". Hans Egon Holthusen störte sich an "schwelgenden Genitivmetaphern" wie "Mühlen des Todes" in Celans Gedichten. Dass diese sich auf Realia bezogen, nämlich die Erfahrung der Lager und des Mordens, wollten die einflussreichen Literaturkritiker, ob sie nun lobten oder tadelten, nicht sehen. Das Publikum "entwirklichte" sozusagen die Gedichte und damit auch ihren Autor. Das sei für Celan wie eine Neuinszenierung des Nazi-Stücks gewesen, so Emmerich.
Mit seiner Studie nuanciert er die Paranoia-Diagnose, wie sie in Teilen der Celan-Forschung vertreten wird. Er bestreitet nicht, dass der egozentrische Celan im Lauf der Sechziger schwer psychisch erkrankte, so dass er sogar versuchte, seine Frau zu töten. Aber er sucht die Gründe für den Krankheitsverlauf mehr in den äußeren Umständen. Emmerich stellt den Verlauf so dar: Der beschädigte und überaus schwierige Mensch Celan geriet erst mit der Verleumdung von Claire Goll - die ihn des Plagiats von Gedichten ihres verstorbenen Mannes Yvan bezichtigt - und den in seinen Augen enttäuschenden Reaktionen von Freunden und Kollegen aus den Fugen. Von da an war in Celans Augen nicht nur etwas, sondern das meiste "faul im Staate D-Mark": Die Plagiatsanschuldigung sollte ihn geistig "auslöschen", nachdem die physische Auslöschung zwischen 1942 und 1945 nicht gelungen war.
Adorno hat 1956 in einem Essay von der "Wunde Heine" gesprochen. Er meinte damit die verdrängte Erinnerung an den ausgestoßenen und heimatlosen Dichter und an das, "was an ihm schmerzt und seinem Verhältnis zur deutschen Tradition". Um einen treffenden Begriff für das Misslingen des deutsch-jüdischen Gesprächs nach dem Judenmord zu finden, böte sich das Wort der "Wunde" auch im Celan-Zusammenhang an. Aber das würde das Gewicht zu sehr auf das Individuum legen. Es gibt ja noch andere Fälle von Überlebenden, die sich in den Siebzigern selbst töteten: Peter Szondi aus der ungarisch-jüdischen Familie Sonnenschein etwa oder Jean Améry, vormals Hans Mayer.
Die tödliche Wunde sollte daher doch besser "Deutschland" heißen und die Mischung aus Verbrechen und dem Leben danach benennen, das wiederum aus Verdrängen, Abwehren, Bestreiten, Rechtfertigen bestand - je nachdem, wie und wo der Einzelne involviert war. Das Opfer Celan sehnte sich nach positiver Resonanz im Land des Täterkollektivs und war als Dichter mit der Kultur dieses Landes symbiotisch verbunden. Da war das Scheitern programmiert. Die Macht der Kollektive scheint angesichts der mörderischen Geschichte stärker gewesen zu sein als der individuelle Wille. Am Ende brachte das nahe Fremde Celan um. Der Tod war abermals ein Meister aus Deutschland.
JÖRG SPÄTER
Wolfgang Emmerich: "Nahe Fremde". Paul Celan und die Deutschen.
Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 400 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main