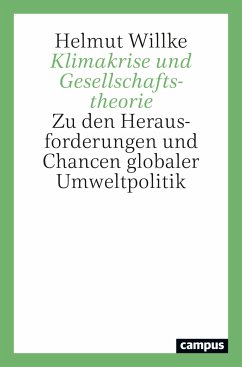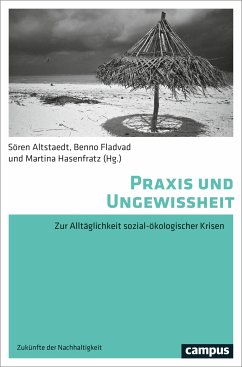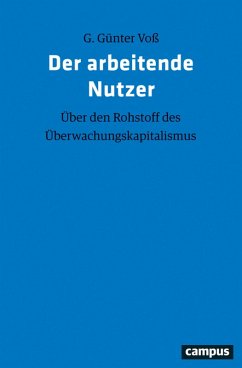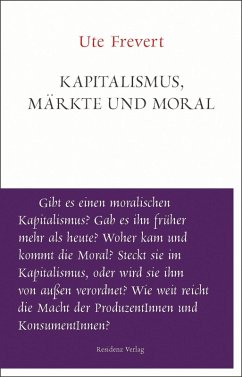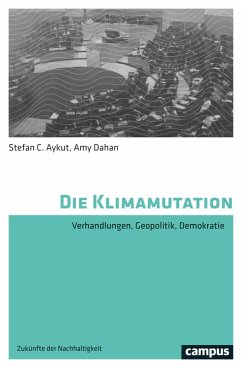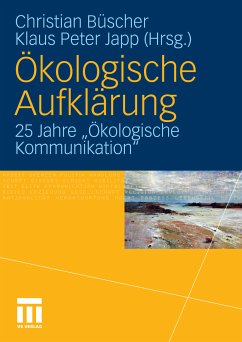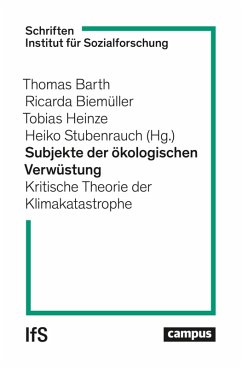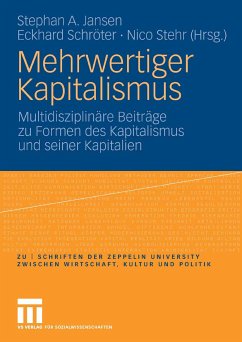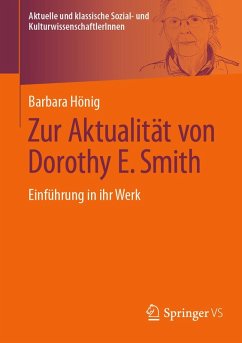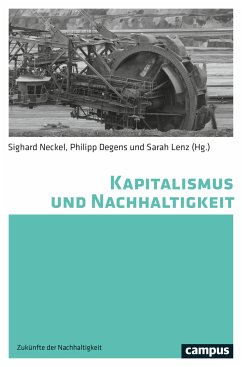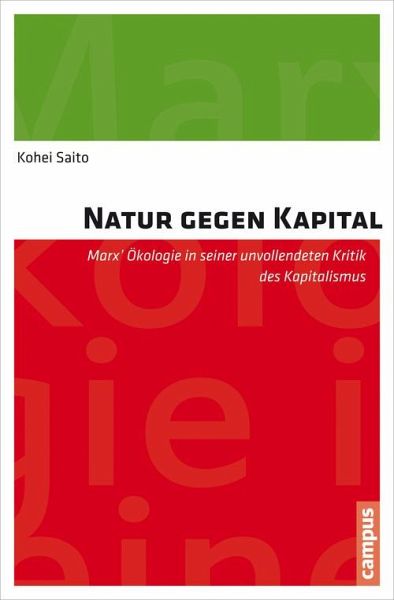
Natur gegen Kapital (eBook, PDF)
Marx' Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 39,95 €**
35,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Marx' Ökologie - dieser Ausdruck klingt wie ein Oxymoron. Hat Marx nicht die absolute menschliche Herrschaft über die Natur propagiert? Angesichts der heutigen globalen ökologischen Krise ist es unumstritten, diese im engen Zusammenhang mit dem kapitalistischen System zu analysieren. Für die Gestaltung einer breiten »roten« und »grünen« Bewegung im 21. Jahrhundert ist deshalb eine Aktualisierung der Marx'schen Theorie unerlässlich. Kohei Saito rekonstruiert systematisch die unvollendete Marx'sche ökologische Kritik des Kapitalismus anhand der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe. Diese g...
Marx' Ökologie - dieser Ausdruck klingt wie ein Oxymoron. Hat Marx nicht die absolute menschliche Herrschaft über die Natur propagiert? Angesichts der heutigen globalen ökologischen Krise ist es unumstritten, diese im engen Zusammenhang mit dem kapitalistischen System zu analysieren. Für die Gestaltung einer breiten »roten« und »grünen« Bewegung im 21. Jahrhundert ist deshalb eine Aktualisierung der Marx'schen Theorie unerlässlich. Kohei Saito rekonstruiert systematisch die unvollendete Marx'sche ökologische Kritik des Kapitalismus anhand der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe. Diese gibt unbekannte naturwissenschaftliche Exzerpte von Marx preis sowie seinen Versuch, den Widerspruch des Kapitalismus als ökologische Krise zu thematisieren.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.