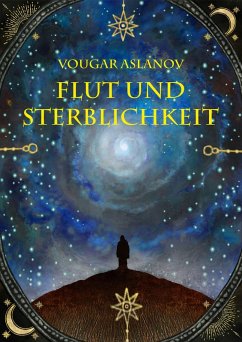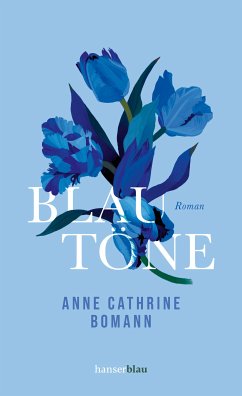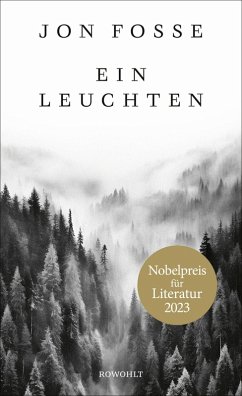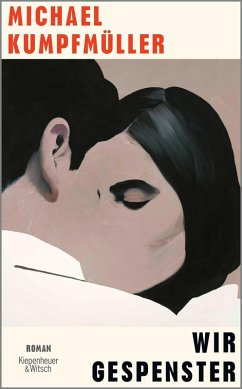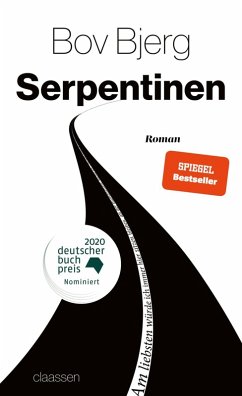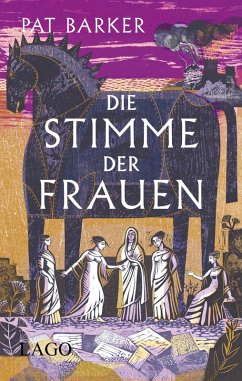Nicht mehr. Mehr nicht (eBook, ePUB)
Chiffren für sie
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Wie zwei voreinander sich rasend entkleiden und wieder ankleiden, das wird, im Zeitraffer gesehen, ihre ganze Geschichte gewesen sein." Dies ist die Geschichte von Gertrud Vormweg, einer Frau, die vom Bild ihres Geliebten nicht loskommt. Er hat sie verlassen: Nun bestimmen Zorn, Sehnsucht und Enttäuschung, Begehren und Aufbegehren Tag und Nacht ihre Gedanken. Doch zugleich mag sie, die Dichterin, nicht sang- und klanglos die Verliererin dieser Liebe sein. Also erzählt sie von sich in der Figur der karthagischen Königin Dido, der großen Verlassenen der Weltliteratur. Und nutzt Verkleidunge...
"Wie zwei voreinander sich rasend entkleiden und wieder ankleiden, das wird, im Zeitraffer gesehen, ihre ganze Geschichte gewesen sein." Dies ist die Geschichte von Gertrud Vormweg, einer Frau, die vom Bild ihres Geliebten nicht loskommt. Er hat sie verlassen: Nun bestimmen Zorn, Sehnsucht und Enttäuschung, Begehren und Aufbegehren Tag und Nacht ihre Gedanken. Doch zugleich mag sie, die Dichterin, nicht sang- und klanglos die Verliererin dieser Liebe sein. Also erzählt sie von sich in der Figur der karthagischen Königin Dido, der großen Verlassenen der Weltliteratur. Und nutzt Verkleidungen, Chiffren der Literatur, um der Banalität des Geschehenen nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. "Wenn schon allein, dann unter Vorbildern begraben." In vielen Stimmen, vielen Tonlagen, aus vielfältigen Zuständen entwirft Botho Strauß diese Erzählung einer Verlassenen und setzt damit Bewusstseinsgeschichten der Moderne fort.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.