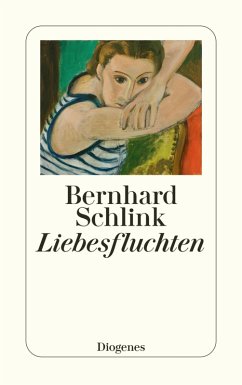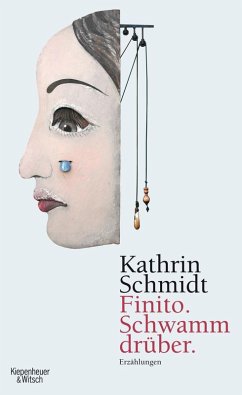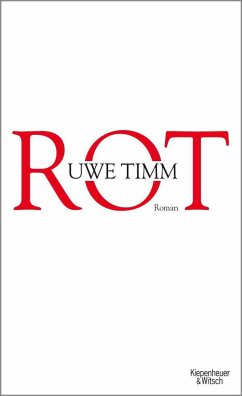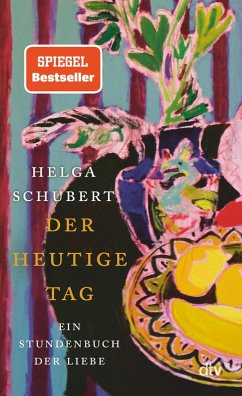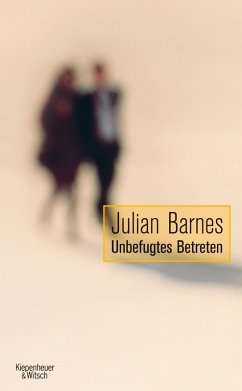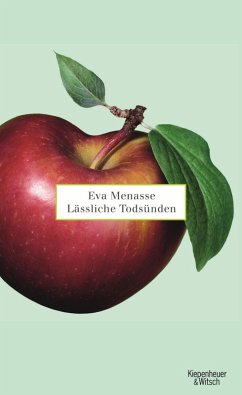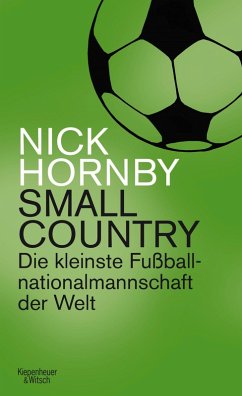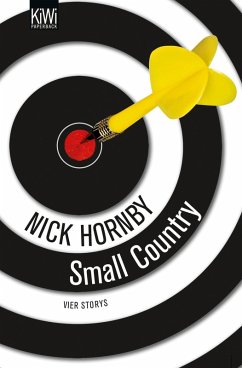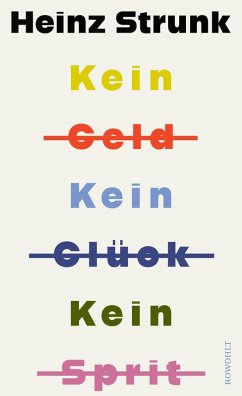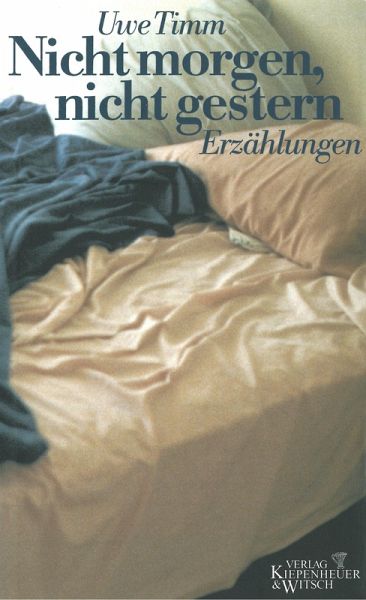
Nicht morgen, nicht gestern (eBook, ePUB)
Erzählungen
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In den Geschichten dieses Buches folgt Uwe Timm der Spur des Wunderbaren, das in scheinbar gewöhnlichen Alltagssituationen nistet. Mit seinem absoluten Gehör für die gesprochene Sprache, voller Sinn für Ironie und Situationskomik, erzählt Timm von überraschenden Wendungen im Leben seiner Figuren. Wie kann ein einziges Abendessen eine recht ungewöhnliche Ehe beenden, und was wird aus der blutjungen Frau, die mit verdorbenem Magen aus der Wohnung flieht? Wie wird sie, die ewig Ungeschickte, ihr Leben meistern? Was mag der Fahrer eines Lastwagens, von zwei jungen Frauen engagiert, wohl von...
In den Geschichten dieses Buches folgt Uwe Timm der Spur des Wunderbaren, das in scheinbar gewöhnlichen Alltagssituationen nistet. Mit seinem absoluten Gehör für die gesprochene Sprache, voller Sinn für Ironie und Situationskomik, erzählt Timm von überraschenden Wendungen im Leben seiner Figuren. Wie kann ein einziges Abendessen eine recht ungewöhnliche Ehe beenden, und was wird aus der blutjungen Frau, die mit verdorbenem Magen aus der Wohnung flieht? Wie wird sie, die ewig Ungeschickte, ihr Leben meistern? Was mag der Fahrer eines Lastwagens, von zwei jungen Frauen engagiert, wohl von der Tour nach Polen in den Westen transportieren und warum lässt er den Wagen dann einfach stehen? Und welch tückische Rolle kann ein Schließfach im Leben eines Querkopfes spielen?
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.