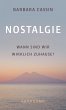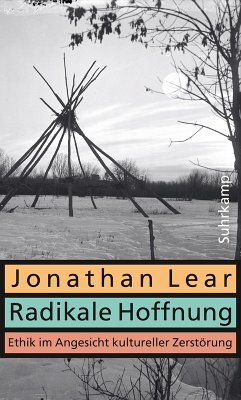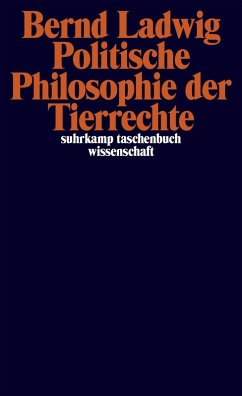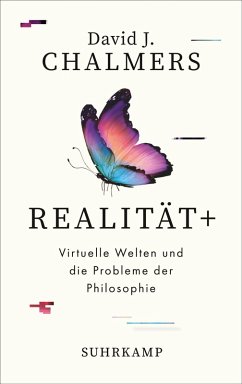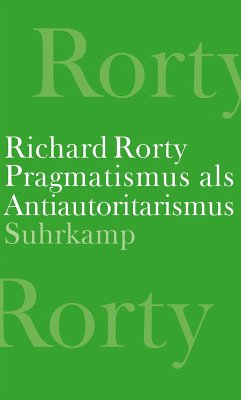Nostalgie (eBook, ePUB)
Wann sind wir wirklich zuhause?
Übersetzer: Pries, Christine
Sofort per Download lieferbar
Statt: 16,00 €**
15,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Warum fühlen wir uns manchmal wie Fremde, auch wenn wir zuhause sind? Und warum, so fragt sich Barbara Cassin, empfinde ich umgekehrt Nostalgie, wenn ich an Korsika denke, obwohl ich meine Wurzeln nicht dort habe? In ihrem gefeierten Essay erforscht sie dieses starke Gefühl und die universellen Themen von Flucht, Exil und Sehnsucht nach einer Heimat, indem sie zwei Gründungstexte der westlichen Kultur neu liest: Homers Odyssee und Vergils Aeneis. In einer brillanten Analyse des Werks der Exilantin Hannah Arendt zeigt Cassin dann, wie die Sehnsucht nach Heimat angesichts ihrer oft fatalen Fo...
Warum fühlen wir uns manchmal wie Fremde, auch wenn wir zuhause sind? Und warum, so fragt sich Barbara Cassin, empfinde ich umgekehrt Nostalgie, wenn ich an Korsika denke, obwohl ich meine Wurzeln nicht dort habe? In ihrem gefeierten Essay erforscht sie dieses starke Gefühl und die universellen Themen von Flucht, Exil und Sehnsucht nach einer Heimat, indem sie zwei Gründungstexte der westlichen Kultur neu liest: Homers Odyssee und Vergils Aeneis. In einer brillanten Analyse des Werks der Exilantin Hannah Arendt zeigt Cassin dann, wie die Sehnsucht nach Heimat angesichts ihrer oft fatalen Folgen neu gedacht werden sollte, nämlich in Begriffen der Sprache statt des Territoriums.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.