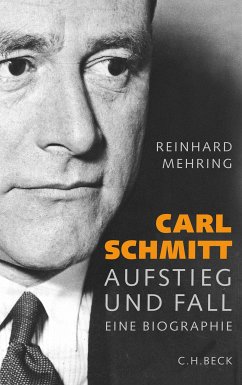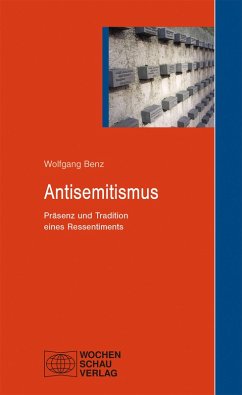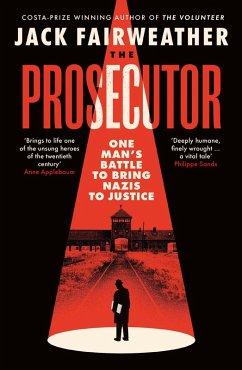Opfernationalismus (eBook, ePUB)
Erinnerung und Herrschaft in der postkolonialen Welt
Übersetzer: Mogultay, Utku
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
17,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Während der Nationalismus seine Begründung früher in Heldengeschichten des unbesiegbaren Volkes fand, schöpfen heute weltweit immer mehr Staaten und Nationen ihr Selbstbewusstsein aus einer Opfergeschichte - und leiten daraus einen Status ab, der sogar vererbt werden soll. Mit vergleichendem Blick auf Polen, Deutschland, Israel, Japan und Südkorea zeigt Jie-Hyun Lim scharfsinnig, welche Probleme ein solcher Opfernationalismus mit sich bringt, wenn er sich als Machtpolitik formiert: Vergangenheit wird verfälscht, die Opfer selbst werden mitunter unsichtbar gemacht und Herrschaft legitimie...
Während der Nationalismus seine Begründung früher in Heldengeschichten des unbesiegbaren Volkes fand, schöpfen heute weltweit immer mehr Staaten und Nationen ihr Selbstbewusstsein aus einer Opfergeschichte - und leiten daraus einen Status ab, der sogar vererbt werden soll. Mit vergleichendem Blick auf Polen, Deutschland, Israel, Japan und Südkorea zeigt Jie-Hyun Lim scharfsinnig, welche Probleme ein solcher Opfernationalismus mit sich bringt, wenn er sich als Machtpolitik formiert: Vergangenheit wird verfälscht, die Opfer selbst werden mitunter unsichtbar gemacht und Herrschaft legitimiert. Indem er dabei konsequent die Perspektive vom europäischen Zentrum löst und in den Globalen Osten verlagert, wird deutlich, wie die historischen Katastrophen im Gedenken weltweit in Beziehung gesetzt und abgeglichen werden, sich erklären und in Konkurrenz zueinander geraten. In seinen wegweisenden Überlegungen entwirft Lim die Grundzüge für einen globalen Erinnerungsraum, der auf Anteilnahme und Diversität beruht und zugleich historisch trennscharf bleibt. Ein unverzichtbarer Beitrag für die Debatten um eine Geschichtspolitik der Zukunft in der postkolonialen Welt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.