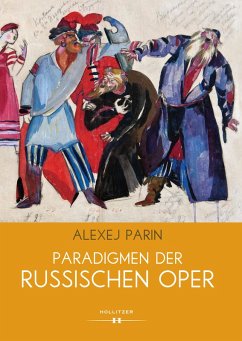Warum ist die Herrscherfigur in der russischen Oper so allmächtig? Welche Psychologie und nationale Identitäten verbergen sich hinter diesen Charakteren? Warum werden die singenden und tanzenden Gegenspieler immer so bezaubernd und gleichzeitig so furchterregend dargestellt? Wer verbirgt sich wirklich hinter den Feindbildern der russischen Komponisten? Wie schlagen sich die zwei großen Überlieferungen - das ,heilige Russland' und der Mythos Sankt Petersburg - und ihr Machtspiel in der Oper nieder? Welche Mythen oder Symbole liegen Figuren wie Boris Godunow und Marfa, Kontschak und der Alten Gräfin, Tatjana und German, Polen und Kitesch zugrunde? Wie sind die Geschlechterrollen in der russischen Oper definiert? Der renommierte russische Opernkritiker Alexej Parin beantwortet diese und viele andere Fragen mit einer klaren, jedoch vielschichtigen Sprache und setzt die russische Oper in einen europäischen Kontext. Dabei nähert er sich der russischen Oper aus verschiedenen Blickwinkeln und unter Einsatz eines erstaunlich vielschichtigen Methodenapparats: Ansätze der Kulturgeschichte, Geschichtsphilosophie, Gender-Studies, Mythologie sowie der analytischen Psychologie und philosophischen Hermeneutik werden herangezogen, um die russische Operngeschichte - von Werstowski und Glinka bis Prokofjew und Schostakowitsch - in ihrem ganzen Facettenreichtum darzustellen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Und das Heilige ist oft nicht weit: Alexej Parin widmet sich kundig der Eigenart klassischer russischer Opern
Wer russische Opern hört, gerät in eine Klangwelt mit merkwürdig vergrößerten Figuren. Der Herrscher verkörpert das Schicksal des ganzen Landes, die lyrische Heldin ist zugleich Natursymbol und Heilige, den lyrischen Tenor elektrisiert nicht nur die Liebe. Durch dieses nicht immer leicht sich erschließende Biotop zu führen, dazu ist der Moskauer Dichter, Übersetzer und Musikschriftsteller Alexej Parin, der an russischen und westeuropäischen Opernhäusern gleichermaßen gearbeitet hat, wie kaum ein anderer berufen. Nun ist seine Studie "Paradigmen der russischen Oper" in einer vorzüglichen Übersetzung erschienen.
Dass die russische Kultur, im Unterschied zur westeuropäischen, sich nicht als universell begreift, schlägt sich auch im Musiktheater nieder: etwa in patriotischen Sujets, wie man sie insbesondere bei dem "mächtigen Häuflein" national gesinnter Komponisten um Modest Mussorgski und Nikolai Rimski-Korsakow findet. In deutschen, französischen oder italienischen Opern treten politische Feindfiguren manchmal als orientalische Despoten auf, ein national stilisiertes Idiom fehlt ihnen jedoch, wofür Parin auf Hauptwerke von Rossini, Mozart, Verdi und Puccini verweist. Russische Musikdramen hingegen handeln häufig vom Krieg des eigenen Volkes gegen Invasoren.
Ob Michail Glinkas "Leben für den Zaren", Alexander Borodins "Fürst Igor" oder Rimski-Korsakows "Unsichtbare Stadt Kitesch", der Gegner brilliert dabei auf der Bühne mit effektvollen, oft feurig synkopischen Tanznummern, vorzugsweise in ungeraden Metren. Den Russen sind hingegen eher geradlinige Solo- und Chorgesänge in Vierermetren zugeordnet. Aus solchen klanglichen Charakterisierungen des Anderen spricht sowohl Bewunderung für eine fremde Kultur wie auch die Warnung vor deren Sirenentönen. Dabei kann Exotik durchaus auch Europa bedeuten, etwa wenn in Mussorgskis "Chowanschtschina" der Titelheld in persischen Tänzen schwelgt, die klingen wie französische Ballettmusik.
Ein weiteres Merkmal ist die häufige Nähe zur sakralen Sphäre, selbst bei dem "Westler" unter den russischen Komponisten, Peter Tschaikowsky. Seiner "Jungfrau von Orléans" liegt Friedrich Schillers Tragödie zugrunde. Doch Tschaikowsky macht aus der Heldin eine russische Heilige, ekstatisch fromm und leidensfähig, die freiwillig den Scheiterhaufen besteigt. Auch Mussorgskis "Chowanschtschina" mündet in einen religiösen Akt, die Selbstverbrennung der Altgläubigen, die so ihre Seelen retten wollen. Parin legt Wert darauf, dass das Flammenmysterium in beiden Fällen eine österliche Qualität habe und auch Auferstehung bedeute, im Gegensatz zu den vor allem rächenden Flammen am Ende von Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen".
In einer luziden Gegenüberstellung des Wagnerschen "Parsifal" mit dem "russischen Parsifal" von Rimski-Korsakow, nämlich dessen Mysterienspiel von der "Unsichtbaren Stadt Kitesch", arbeitet Parin die unterschiedlichen religiösen Weltmodelle heraus. Bei Wagner ist der überschaubare Raum des Bühnenweihfestspiels klar unterteilt in die heilige Zone der asketischen Gralsritter und die des bösen Klingsor mit seinem Zaubergarten. Bei Rimski-Korsakow hingegen verkörpert eine mildtätige Jungfrau die Harmonie mit der Natur. In der grenzenlosen Ebene von "Kitesch" kommt der Überfall der Tataren aus dem Nichts, Böse und Gut vermischen sich. Das heilige Russland, die Stadt Kitesch, wird vom See Swetlojar überflutet und so der historischen Zeit entrückt. Auch die Heldin Fewronia kann sich nur retten, indem sie sich aufmacht in ein Jenseits, das möglicherweise jenseits ihrer Phantasie nicht existiert.
Dass in Russland die Herrschaft des Menschen über den Menschen durch Gesetze nur wenig gebändigt wird, merkt man auch den Opern an. Historische Entwicklung erscheint fast durchgehend leidvoll. Im alten vormongolischen Russland, wie es etwa Borodins "Fürst Igor" und Glinkas "Ruslan und Ljudmila" beschwören, verkörpert der Machthaber noch die christliche Tugend, die freilich von außen angegriffen wird. Im Moskowitischen Zentralstaat, den Mussorgski im "Boris Godunow" und in der "Chowanschtschina" vergegenwärtigt, bewahrt der Zar beziehungsweise Fürst zwar die sakrale Ordnung, bringt der politischen aber Blutopfer dar und endet selbst tragisch. In der Romanow-Epoche schließlich, die in der zweiten Hälfte von "Chowanschtschina", aber auch im Finale von "Ein Leben für den Zaren" anbricht, ist der Herrscher ein säkularer Machtgötze geworden.
Parin schöpft aus einem gewaltigen Fundus von Kenntnissen. Virtuos vergleicht er Sängerdarsteller, Inszenierungen, macht Ausflüge in Philosophie und Psychoanalyse. Wunderbar ist sein Hymnus auf die Figur der Tatjana aus Tschaikowskys "Eugen Onegin". Im Gegensatz zu großen Liebesgeschichten der europäischen Literatur, in denen die Leidenschaft immer auch physisch vollzogen wird, verherrlicht die klassische russische Oper gern die Einsamkeit des Eros. Tatjana liebt Onegin leidenschaftlich. Doch sie bringt deswegen nicht die gesellschaftliche und eheliche Ordnung zum Einsturz, sondern macht ihre Probleme mit sich selbst aus.
Schade nur, dass in Parins ausgreifenden Textanalysen die der musikalischen Texte, der Partituren, eine eher untergeordnete Rolle spielen. So muss man hoffen, dass auch das Buch "Fünf Opern und eine Symphonie" des russisch-amerikanischen Slawisten Boris Gasparow, der die Musiksprache der wichtigsten russischen Opern beispielhaft erschließt, eines Tages ins Deutsche übersetzt wird.
KERSTIN HOLM
Alexej Parin: "Paradigmen der russischen Oper".
Aus dem Russischen von Anastasia Risch und Christiane Stachau. Hollitzer Verlag, Wien 2016. 296 S., geb., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main