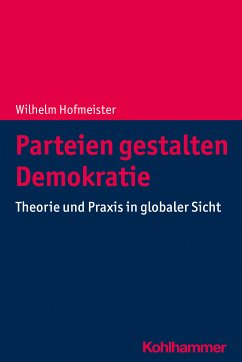Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Wilhelm Hofmeister verhebt sich beim Versuch einer vergleichenden Gesamtdarstellung
Die Rede von der Krise der Parteiendemokratie ist nicht neu. Betrachtet man allein die Bundesrepublik, könnte man wahrscheinlich für jedes der vergangenen fünf Jahrzehnte entsprechende Buchtitel aus dem Regal ziehen. Legitimations- und Repräsentationsschwächen der Parteien und des Parteiensystems liegen freilich in der Natur der Demokratie selbst, die ja ihrer Idee nach eine Staatsform des Misstrauens ist. Die in der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte regelmäßig mit Besorgnis vorgetragenen Befunde, wonach die Parteien unter allen staatlichen Institutionen das geringste Ansehen genießen, sollten daher mit Vorsicht betrachtet werden. Verwunderlich wäre eher das Gegenteil.
Dennoch ist es nicht ganz falsch, wenn Forscher für die vergangenen knapp zwei Jahrzehnte eine "Krise der Demokratie" ausmachen. Der nüchterne Blick auf die Zahlen zeigt, dass der seit den 1990er-Jahren beobachtbare weltweite Vormarsch der demokratischen Herrschaftsformen seit etwa Mitte der 2000er-Jahre zum Ende gekommen ist. Die regressiven Tendenzen betreffen dabei nicht nur Länder wie Russland oder die Türkei, die seinerzeit noch als demokratische Hoffnungsträger galten, sondern machen auch vor scheinbar fest etablierten jungen Demokratien wie Ungarn oder Polen nicht halt. Selbst die USA - das Mutterland der modernen neuzeitlichen Republik - müssen sich heute nach der Stabilität und Funktionsfähigkeit ihrer demokratischen Institutionen fragen lassen.
Wilhelm Hofmeister legt eine Gesamtdarstellung der Parteiendemokratie(n) vor, die vom Gros der vergleichbaren Arbeiten in der Politikwissenschaft in zweierlei Hinsicht abweicht. Einerseits beschränkt sich das Buch nicht auf die alten und neuen Demokratien des Westens, sondern beleuchtet auch nichtwestliche Regionen wie Afrika, Asien und Lateinamerika, die der Autor aus seiner eigenen Auslandstätigkeit in der Konrad-Adenauer-Stiftung kennt. Und zweitens nimmt es eine Zwischenstellung zwischen einer fach- und populärwissenschaftlichen Perspektive ein, indem es die Auseinandersetzung mit der Forschungsdiskussion kurz hält und Aspekte sowohl der politischen Bildung als auch der Praxis in den Vordergrund rückt. Was auf der einen Seite an wissenschaftlicher Struktur und Stringenz fehlt, wird auf der anderen Seite durch eine eingängige Präsentation des Stoffes und gute Lesbarkeit ausgeglichen.
Die globale Perspektive ist löblich, führt aber notgedrungen zu einer Überdehnung, da Gestalt und Funktionen der Parteien in den etablierten Demokratien ganz andere sind als in den nichtetablierten. Das Missverständnis beginnt hier bereits mit der Feststellung, die Demokratie sei heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts, die häufigste Form politischer Ordnung. Das ist sie mitnichten beziehungsweise nur dann, wenn man von der Selbstbezeichnung der Staaten ausgeht. Parteien begegnen uns deshalb wie selbstverständlich auch in nichtdemokratischen Systemen. Selbst die totalitären Einparteienregime der Zwischenkriegszeit oder des Realsozialismus haben auf die Organisationsform "Partei" Wert gelegt.
Entsprechend kursorisch fallen die Hinweise und Ausführungen zu den nichtwestlichen Ländern aus. So präsentiert der Autor zum Beispiel eine Tabelle, aus der hervorgeht, dass das Vertrauen der Bürger in den afrikanischen Ländern im Durchschnitt etwa dreimal so hoch ist wie in Europa oder Lateinamerika. Was das zu bedeuten hat, erfährt man nicht. Umgekehrt werden die immensen Unterschiede, die in puncto Vertrauen und Demokratiezufriedenheit zwischen den verschiedenen Regionen Europas - Nord-, West-, Süd- und Mittelosteuropa - bestehen, in der Darstellung weitgehend ausgeblendet. Warum sind im Norden und Westen rechtspopulistische und im Süden linkspopulistische Parteien erfolgreicher? Und wie lässt sich das Aufkommen einer spezifischen Form des Nationalpopulismus in den mittel- und osteuropäischen Staaten erklären? Hier wäre auch mit Blick auf die Bundesrepublik eine gründlichere Analyse angezeigt gewesen, handelt es sich doch beim heutigen Ostdeutschland ebenfalls um eine "postkommunistische" Gesellschaft.
Umgekehrt enthält das Buch bei der Darstellung der Probleme der etablierten westeuropäischen Parteiensysteme wenig Originelles. Warum neben Deutschland nur die deutschsprachigen Länder Österreich und Schweiz in kurz gehaltenen, eigenen Fallstudien bedacht werden, erschließt sich nicht. An vergleichendem Zahlenmaterial fehlt es in diesem Teil völlig. Überzeugender geraten die Ausführungen zu den Ideologien und Parteiprogrammen und vor allem zur Parteiorganisation in den nachfolgenden Kapiteln, die das Thema mehr aus praktischer Perspektive beleuchten und zum Teil stark an das bundesdeutsche Beispiel angelehnt sind. Hier wie auch in den Kapiteln über die neuen Kommunikations- und Wahlkampfformen der Parteien ist der Ertrag und Neuigkeitswert des Buches am größten.
Ärgerlich fallen die Darlegungen zur Parteienfinanzierung und zum Wahlsystem in der Bundesrepublik aus. Zum einen blenden sie die Rolle des Verfassungsgerichts gänzlich aus, die ja auch aus demokratietheoretischer Sicht mit Blick auf das Verhältnis zu den Parteien gravierende Fragen aufwirft. Und zum anderen kolportieren sie das leider auch in anderen wissenschaftlichen Darstellungen verbreitete Missverständnis, Deutschland weise ein "gemischtes" Wahlsystem auf, in welchem nur die "zweite Hälfte der Mandate im Verhältnis zum Stimmenanteil der einzelnen Parteien vergeben werden". In Wirklichkeit sind es alle Mandate. Solche Schnitzer sollten in einem Buch, das politische Aufklärung betreiben will, nicht vorkommen.
Unter dem Strich bleibt mithin ein zwiespältiger Eindruck. Der Autor hat sich gleichzeitig zu viel und zu wenig vorgenommen - zu viel, weil er das Thema Parteiendemokratie in der ganzen Breite abhandeln möchte und sich dabei nicht nur auf die etablierten demokratischen Systeme beschränkt, und zu wenig, weil zentrale wissenschaftliche Fragestellungen in der gerafften Darstellung notwendig auf der Strecke bleiben. Als Einstieg in die vergleichende Betrachtung von Parteien und Parteiensystemen ist das Werk auch für ein Nichtfachpublikum zu empfehlen. Als politikwissenschaftliches Lehrbuch wird es sich vermutlich eher nicht durchsetzen. FRANK DECKER
Wilhelm Hofmeister: Parteien gestalten Demokratie. Theorie und Praxis in globaler Sicht.
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2021. 377 S., 29 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH