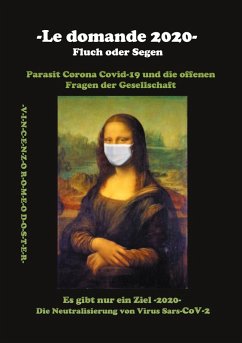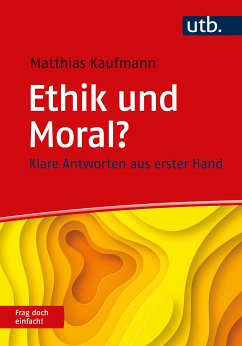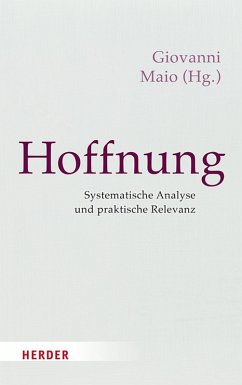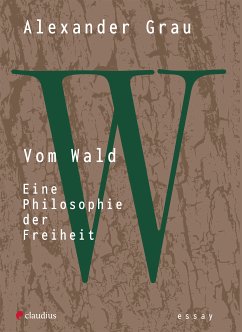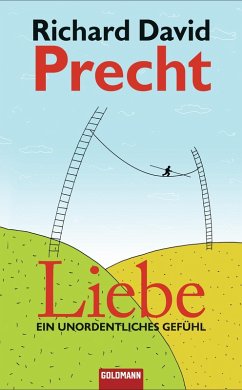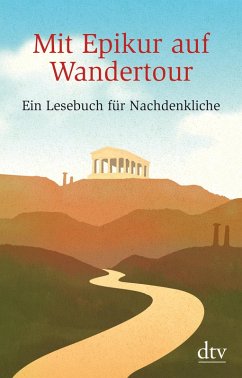Philosophie der Sorge (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
16,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Zur menschlichen Existenz gehört elementar die Sorge. Sie besitzt vielerlei Formen: Fürsorge, Selbstsorge, Pflege oder medizinische Vorsorge. Spätestens mit der Pandemie wurde klar, dass der Körper nicht mehr Privatbesitz des Subjekts ist. Stattdessen wurde das leibliche Wohl beinahe vollständig sozialisiert, bürokratisiert und politisiert. Das Ich scheint die Selbstbestimmung an ein Gesundheits-System abgetreten zu haben. Der Philosoph Boris Groys lotet in seinem neuen Buch aus, ob und wie diese Autonomie wieder zurückgewonnen werden kann.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.