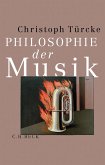Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Im Swing der Begriffe: Daniel M. Feige riskiert eine Philosophie des Jazz
Es hat lange gedauert, bis die Philosophie hellhörig für den Jazz wurde. Theodor W. Adorno musste derweil stellvertretend für die Zunft viele Prügel einstecken. Denn seine Ideologiekritik legte sich einen Jazz zurecht, der allein aus Stereotypen der Swing-Musik besteht. Nun ist ein Büchlein erschienen, das dieser unrühmlichen Periode zumal der deutschen Philosophie ein Ende setzt. Der Autor, Daniel Martin Feige, ist promovierter Philosoph und selbst Jazzmusiker.
Aber was kann die Philosophie über den Jazz eigentlich sagen? Diese Frage kann man selbstredend nicht beantworten, ohne zugleich zu sagen, was man unter Philosophie verstehen möchte. Feige schließt sich da einer etwas bieder klingenden Bestimmung an. Philosophie gehe es um eine "Klärung der für unser Selbst- und Weltverständnis wesentlichen Grundbegriffe." Nun kann man zwar sicher nicht behaupten, dass Jazz in eine Reihe gehöre mit Grundbegriffen wie Erkennen und Handeln, Vernunft, Wahrheit und Gerechtigkeit.
Aber sofern wir Jazz gemeinhin als eine spezifisch künstlerische Musik verstehen, eröffnet er eine Perspektive auf den Bereich des Ästhetischen. Sofern die Philosophie also etwas über Kunst und speziell Musik zu sagen hat, gehört auch der Jazz zu ihren Themen.
Mit Blick auf den Jazz schließt Feige an ein gängiges Verständnis an, das ihn in Kontrast zu Werken der europäischen Kunstmusik sieht. Im Jazz wird improvisiert, während in der europäischen Kunstmusik komponiert wird. Im Jazz steht die musikalische Persönlichkeit im Zentrum, während sie in der europäischen Kunstmusik zurücktritt. Doch das ist keineswegs überzeugend. Ein Kontrast, das macht der Autor deutlich, ist eben keine strikte Unterscheidung. Am Ende gewinnt man auf diese Weise ein besseres Verständnis eingeschliffener Gegensatzpaare, mit der abschließenden und etwas weit ausholenden These, dass Jazz etwas explizit mache, was nicht nur für Musik, sondern für Kunst als solche wesentlich sei. Freilich ist diese These, wie Feige selbst zugesteht, mit Vorsicht zu genießen. Um etwa einzusehen, dass jedes neue Kunstwerk in einer kritischen Auseinandersetzung mit vorangegangenen Werken steht, muss man ja nicht die spezifische "dialogische Interaktion" im Falle des Jazz heranziehen.
Der Autor erweist sich als begriffsanalytisch geschulter Philosoph und als Kenner der Musik. Aber selbst wenn er sich um Klarheit bemüht: Das schmale Buch hält sich zu sehr an akademische Üblichkeiten und ist auch unübersehbar als Einführungstext konzipiert.
Offenbar hat der Autor sich vom Verlag einreden lassen, man könne deutschsprachigen Lesern ein Buch über den Jazz nur im derzeit allgegenwärtigen Einführungsstil zumuten. Das geht so weit, dass stets wieder am Beginn eines neuen Satzes wortwörtlich wiederholt wird, was im vorhergehenden Satz, meist als Frage, schon gesagt worden ist, so als traue man den Lesern nicht zu, selbst die Verbindung herzustellen. Wünschenswert wäre es gewesen, der Autor hätte in diesem Falle den Musiker in sich mehr zu Wort kommen lassen und die alte Jazzer-Parole beherzigt: "Make it swing!" So liegt also noch kein Meisterstück vor in der Philosophie des Jazz. Aber ein Anfang ist gemacht.
JOSEF FRÜCHTL.
Daniel Martin Feige: "Philosophie des Jazz".
Suhrkamp Verlag, Berlin 2014. 142 S., br., 14,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main