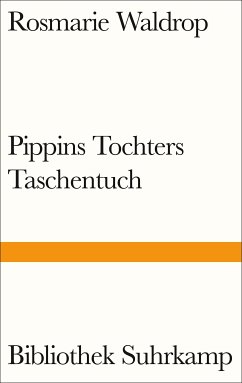Das fragt - ein halbes Jahrhundert später - Lucy, die älteste Tochter, in Briefen an ihre Schwester (oder ist es ihre Halbschwester?). Hätte ihre Mutter nur ein Machtwort sprechen müssen, was die Musik Richard Wagners angeht, damit sich alles ganz anders entwickelt? Und hat der Umstand, dass Frederikas Liebhaber Jude war, Josefs Faszination für den Nationalsozialismus weiter entfacht?
Rosmarie Waldrop hat einen agilen, feinsinnigen und derben Roman geschrieben. Über eine marode Familie im anschwellenden Nationalsozialismus. Über Sehnsüchte, Enttäuschungen und Verrat. Über kleine Ursachen und große Wirkungen. Und über die beharrliche Ambivalenz einer nicht wirklich zu bewältigenden Vergangenheit.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Rosmarie Waldrops Roman "Pippins Tochters Taschentuch" als Übersetzungsleistung
Genealogisches Erzählen verläuft nach dem Motto: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Man weiß nie, ob die Nachkömmlinge nicht dieselben Charakterschwächen haben wie man selbst. Dieses familiäre Gleichheitsprinzip bestimmt schon die griechische Mythologie. Wenn etwa Kronos, nachdem er seinen Vater entmachtet hat, seine eigenen Kinder frisst. Rosmarie Waldrops "Pippins Tochters Taschentuch" frischt diese Erzählweise in spezifisch weiblicher Variante auf. Waldrop, 1934 in Kitzingen am Main geboren, ist in den Vereinigten Staaten eine der renommiertesten Avantgarde-Dichterinnen. In Deutschland ist sie nur in Lyrikkreisen bekannt. Mit "Pippins Tochters Taschentuch", im Original 1986 erschienen, wird sich das hoffentlich ändern.
Lucy, die Erzählerin dieses ebenso hinreißenden wie klugen Buches, befürchtet, sie und ihre beiden Schwestern hätten von der Mutter eine gemeinsame Eigenschaft geerbt: den Hang zur Untreue. Der einzige Unterschied zwischen den drei Geschwistern liege darin, wie sie mit diesem mütterlichen Erbe umgehen: Doria, die Älteste, hat sich in die Sicherheit ihrer fünfköpfigen Kinderschar gebracht. Andrea, ihre Zwillingsschwester, hatte sich in ein Kloster zurückgezogen. Und Lucy, die Musikerin, liebt den Jazzer Laff, betrügt somit aber ihren in sich verschachtelten Ehemann Bob. Damit wiederholt sie das Verhalten ihrer Mutter. Denn die wunderbar exzentrische Frederika war mit Josef verheiratet, liebte aber dessen musikbegeisterten besten Freund Franz. Und der wiederum kommt unbedingt als möglicher Vater der Zwillinge in Frage.
Jetzt sitzt Lucy also, nachdem sie Deutschland in Richtung Amerika verlassen hat, da und fragt sich: Ist das Zufall, wenn ich das Verhalten meiner Mutter wiederhole? Oder Schicksal? Und wenn es kein Zufall sein sollte: Wer oder was durchkreuzt mein geordnetes Leben? Exakt dieses Durchkreuzen der Liebes- und Familienordnung treibt Waldrop mit größtem Vergnügen auf die Spitze. Etwa bei der Taufe der Zwillinge. Da hat die Mutter sich angeblich dazu entschlossen, ihre Kinder nach Andrea Doria zu benennen. Dann aber brüllt das jüngere Mädchen bei der Taufe so maßlos, dass es vorgezogen wird und den Namen erhält, der für die ältere Schwester vorgesehen war. Schon heißen die Kinder Doria Andrea. So funktioniert Rosmarie Waldrops Humor. Er ist für alle, die Shakespeaeres Kapriolen oder Jean Pauls Witz etwas abgewinnen können, die hellste Freude.
So viel Genealogie muss zwischen Autorin und Erzählerin schon sein: Lucy fällt in Sachen Sprach- und Überkreuzungslust nicht weit vom Stamm. Sie ist in ihrem fortgesetzten schriftlichen Dialog mit der Schwester Andrea hellsichtig, gedankenschnell, treffsicher, frech und temperamentvoll bis zur Wutrede. Über die in ihrer Familie verbreitete Liebe zu Richard Wagner etwa schimpft sie: "Was habe ich verbrochen, dass ich auf Schritt und Tritt von Wagnerianern verfolgt werde?" Um dann gegenüber ihrer Schwester Andrea nachzulegen: "Wagner ist ein weiteres trübes Geheimnis, das mir ungreifbar bleibt. So wie ich an deiner Religion keinen Geschmack fand, ganz zu schweigen von deinem Kloster. Spring jetzt nicht hoch wegen dem ,dein'. Ich weiß, ich weiß, ich rede schon wieder über die Vergangenheit, kletzle an deinen Krusten. Aber ist es vergangen?" Die Vergangenheit ist allgegenwärtig in diesem Briefroman, der sich zugleich der Gattung entzieht. Weil Lucy in einem einzigen, durch Zwischentitel nur provisorisch strukturierten Schreibfluss loswerden muss, was über ihr Leben in den Vereinigten Staaten und das ihrer Mutter in Deutschland zu sagen ist.
So überkreuzen sich Lucys Blick auf die Vergangenheit der Eltern mit dem auf ihr eigenes Leben, überlagern sich die Ereignisse im Übergang vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg mit der amerikanischen Gegenwart, fließen die Erfahrungen der Eltern in Bayreuth und Kitzingen mit Lucys Leben ineinander. Spätestens mit der Machtergreifung der Nazis bekommt die Ehebruchsfarce einen tragischen Unterstrom: Franz Huber, der Liebhaber der Mutter, war Jude. Die ungeklärte Vaterschaft wird zur Frage um Leben und Tod. Was passiert, wenn Josef sich nicht zum leiblichen Vater erklärt? Was geschieht mit der Mutter, den Zwillingen, der jüngeren Schwester? Und wenn das Schicksal der Frauen auf Messers Schneide stand, warum wird das in dieser Familie nicht erinnert? Von diesen Fragen erzählt der Roman auf eindrücklichste Weise.
In diesem Zusammenhang erklärt sich auch der seltsam anmutende Romantitel: "Pippins Tochters Taschentuch" trägt alle Kennzeichen einer weiblichen Genealogie. Die Frau bleibt namenlos. Sie wird nur über ihre Beziehung zum Vater erinnert. Und über ihr Attribut, das zu Legende wird. Pippins Tochter, so heißt es, habe von einer Anhöhe aus ihr Taschentuch dem Wind anvertraut. Wo es landete, da sollte Kitzingen entstehen - Lucys wie Rosmarie Waldrops Geburtsstadt. Der Fall eines Taschentuchs - mehr, so betont Lucy immer wieder, bleibt nicht einmal vom Leben einer Königstochter.
Das alles ist so rasant erzählt, wird von einem solchen Sprach- und Klangzauber getragen, dass man sich fragt, wer soll das übersetzen? Ann Cotten! Ihrerseits bilingual aufgewachsen, hat sie hier Außergewöhnliches geleistet. Ihre Übersetzung ist so treffend wie unverstellt. Etwa wenn Franz und Frederika an ihrer Oper schreiben: "Young man, Yo-ung man / let's no-o-o-t be fo-o-or-mal / what you did / i-i-is no-or-mal." "Junge, Ju-hunge / sei mal nicht zu forma-al, was du geta-an hast / i-i-ist ganz norma-al." Bei Cotten wird aus dem englischen O-Ton der sich windende "A-A-l-Klang". Wunderbar auch ihre Wendung von "This ain't no life / ain't nothing but ache-sistence" in: "Das ist kein Leben, das ist nur Ächz-istenz". Cotten bewahrt in ihrer Lässigkeit jene Melodie, die Waldrops Original in anderer Tonlage anstimmt. Dass dieser Roman, der unablässig über Neuanfang, Wissenstransfer und Übersetzung reflektiert, jetzt in der Kategorie "Übersetzung" auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises steht, erscheint als treffende Pointe. Fehlt nur noch, dass Rosmarie Waldrops Literatur im deutschsprachigen Raum so breite Aufmerksamkeit erhält, wie sie es längst verdient hat. Es ist höchste Zeit.
CHRISTIAN METZ
Rosmarie Waldrop: "Pippins Tochters Taschentuch". Roman.
Aus dem Englischen und Nachbemerkung von Ann Cotten. Nachwort von Ben Lerner. Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 275 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main