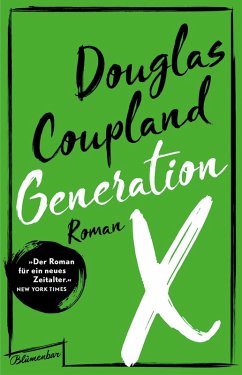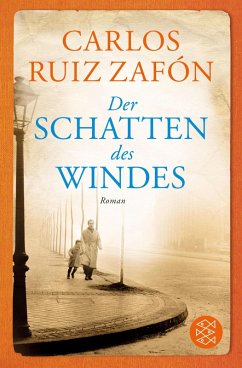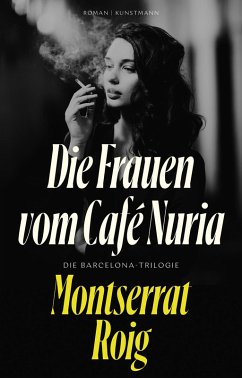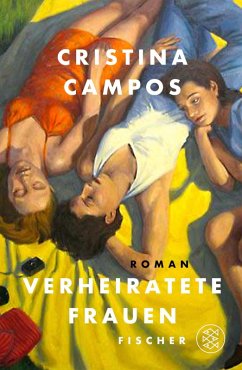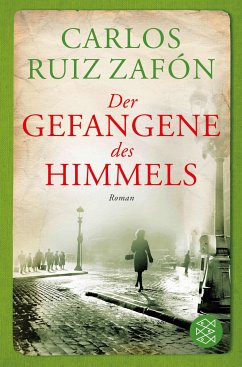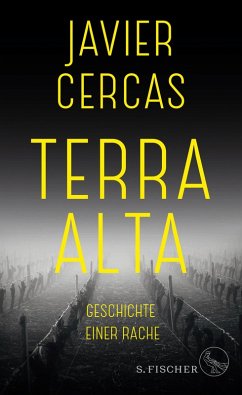Pixeltänzer (eBook, ePUB)
Roman
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Elisabeth, von allen nur Beta genannt, arbeitet in einem Startup: Ihr Alltag wird von Pitches und Teambuilding-Maßnahmen bestimmt; in ihrer spärlichen Freizeit entwickelt sie Tiermodelle am 3D-Drucker und probiert sich durch die Berliner Eisdielen. Als ein Fremder unter dem seltsamen Alias Toboggan sie über eine App kontaktiert, ändert sich ihr Leben. Sein Profilbild weckt ihre Neugier, doch anstelle einer Antwort schickt er sie auf virtuelle Spurensuche.Sie führt Beta zu der Geschichte des Künstlerpaars Lavinia und Walter, das in den Zwanzigerjahren in grotesken Ganzkörpermasken Tanzth...
Elisabeth, von allen nur Beta genannt, arbeitet in einem Startup: Ihr Alltag wird von Pitches und Teambuilding-Maßnahmen bestimmt; in ihrer spärlichen Freizeit entwickelt sie Tiermodelle am 3D-Drucker und probiert sich durch die Berliner Eisdielen. Als ein Fremder unter dem seltsamen Alias Toboggan sie über eine App kontaktiert, ändert sich ihr Leben. Sein Profilbild weckt ihre Neugier, doch anstelle einer Antwort schickt er sie auf virtuelle Spurensuche.Sie führt Beta zu der Geschichte des Künstlerpaars Lavinia und Walter, das in den Zwanzigerjahren in grotesken Ganzkörpermasken Tanztheater aufführte und mit bürgerlichen Konventionen brach. Statt der erhofften Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen kommt es zur Tragödie, als Lavinia zur Waffe greift. Doch je mehr Beta von den beiden erfährt, sich in ihre Hingabe an die Kunst hineinversetzt und mögliche Auswege auslotet, umso stärker wird die Sehnsucht, aus ihrem eigenen oberflächlichen Dasein auszubrechen. Eine Reise nach Barcelona bietet ihr und ihrem Team die ungeahnte Möglichkeit, Technik ins Absurde oder doch in Kunst zu verwandeln - und Beta ergreift ihre Chance.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.deBeta arbeitet in einem Berliner Start-up und wenn sie sich nicht mit der Qualitätskontrolle von Software beschäftigt ist, dreht sie an ihrem Rubikwürfel oder druckt mit ihrem 3-D-Drucker Modelle von Tieren. Eine App, über die man sich von fremden Menschen überall auf der Welt wecken lassen kann, bringt den geheimnisvollen Toboggan in ihr Leben. Fasziniert von seinem Profilbild sucht sie im Internet seine Spuren und stößt auf die Geschichte eines Hamburger Künstlerpaars aus den 20er-Jahren: Lavinia Schulz und Walter Holdt machten mit expressionistischen Tanzaufführungen auf sich aufmerksam, bei denen groteske Ganzkörpermasken zum Einsatz kamen. Berit Glanz hat ihren Debütroman so aufgebaut, dass sich die historische Geschichte der beiden wie bei einer Schnitzeljagd Stück für Stück erschließt. Passend zur Protagonistin sind die Rätsel im virtuellen Raum versteckt. Beta knackt sie alle und ganz nebenbei bekommt ihr von Technik bestimmtes Leben ein belebendes Quäntchen an Unberechenbarkeit, das sie zu ganz neuen Taten beflügelt. Berit Glanz lässt zwei Welten, die ein Jahrhundert voneinander entfernt sind, auf faszinierende Weise ineinandergreifen. Besonders viel Freude machen dabei Absurditäten aus Betas Jetztzeit wie ein lebensechter Roboter-Goldfisch, den sie aus dem Firmen-Aquarium in die Berliner Spree umsiedelt.
buecher-magazin.deBeta arbeitet in einem Berliner Start-up und wenn sie sich nicht mit der Qualitätskontrolle von Software beschäftigt ist, dreht sie an ihrem Rubikwürfel oder druckt mit ihrem 3-D-Drucker Modelle von Tieren. Eine App, über die man sich von fremden Menschen überall auf der Welt wecken lassen kann, bringt den geheimnisvollen Toboggan in ihr Leben. Fasziniert von seinem Profilbild sucht sie im Internet seine Spuren und stößt auf die Geschichte eines Hamburger Künstlerpaars aus den 20er-Jahren: Lavinia Schulz und Walter Holdt machten mit expressionistischen Tanzaufführungen auf sich aufmerksam, bei denen groteske Ganzkörpermasken zum Einsatz kamen. Berit Glanz hat ihren Debütroman so aufgebaut, dass sich die historische Geschichte der beiden wie bei einer Schnitzeljagd Stück für Stück erschließt. Passend zur Protagonistin sind die Rätsel im virtuellen Raum versteckt. Beta knackt sie alle und ganz nebenbei bekommt ihr von Technik bestimmtes Leben ein belebendes Quäntchen an Unberechenbarkeit, das sie zu ganz neuen Taten beflügelt. Berit Glanz lässt zwei Welten, die ein Jahrhundert voneinander entfernt sind, auf faszinierende Weise ineinandergreifen. Besonders viel Freude machen dabei Absurditäten aus Betas Jetztzeit wie ein lebensechter Roboter-Goldfisch, den sie aus dem Firmen-Aquarium in die Berliner Spree umsiedelt.