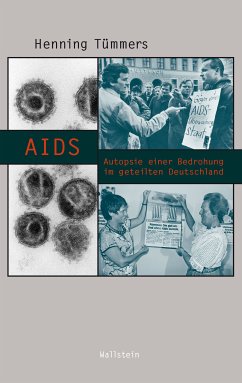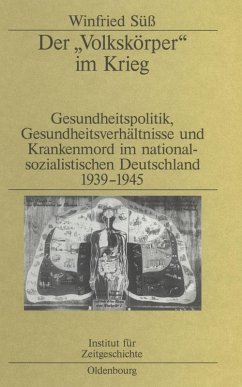Politische Medizin (eBook, PDF)
Das Ministerium für Gesundheitswesen der DDR 1950 bis 1970
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 46,00 €**
37,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Gesundheitspolitik der DDR zwischen NS-Vergangenheit und sozialhygienischer Utopie. Das Gesundheitswesen zählte in der sozialistischen "Fürsorgediktatur" zu den Schlüsselbereichen staatlichen Handelns. Die DDR erhob den Anspruch, die soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod zu beseitigen. Auf der Grundlage sozialhygienischer Ideen versuchten Mediziner und Politiker der DDR, die Gesellschaft zu "heilen". Jutta Braun zeigt, dass der Einfluss der Minister für Gesundheitswesen erschreckend gering war, während die SED-Kader die Entscheidungen trafen. Zudem untersucht sie die NS-Vergangen...
Die Gesundheitspolitik der DDR zwischen NS-Vergangenheit und sozialhygienischer Utopie. Das Gesundheitswesen zählte in der sozialistischen "Fürsorgediktatur" zu den Schlüsselbereichen staatlichen Handelns. Die DDR erhob den Anspruch, die soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod zu beseitigen. Auf der Grundlage sozialhygienischer Ideen versuchten Mediziner und Politiker der DDR, die Gesellschaft zu "heilen". Jutta Braun zeigt, dass der Einfluss der Minister für Gesundheitswesen erschreckend gering war, während die SED-Kader die Entscheidungen trafen. Zudem untersucht sie die NS-Vergangenheit von Mitarbeitern des Ministeriums und den Umgang mit den nationalsozialistischen Verbrechen im Gesundheitswesen. Weiterhin geht die Autorin der Frage nach, wie sich die Politik des SED-Staates auf die gesundheitliche Versorgung seiner Bürger auswirkte: So konnten durch staatlich angeordnete Impfungen Infektionskrankheiten erfolgreich bekämpft werden. Doch entstanden zugleich neue Asymmetrien im Zugang zu gesundheitlichen Leistungen. Jutta Braun untersucht darüber hinaus die politische Rolle der Arbeitsmedizin, den Systemwettstreit mit der Bundesrepublik sowie Fälle politischer Repression.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.