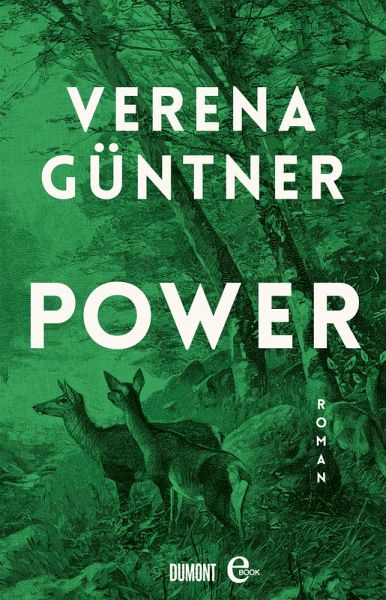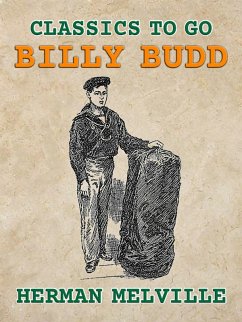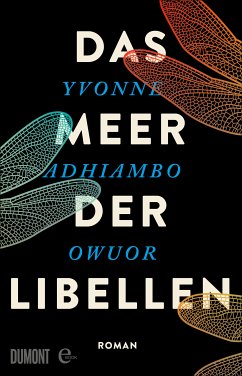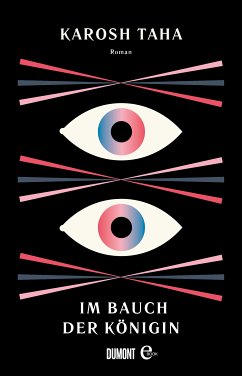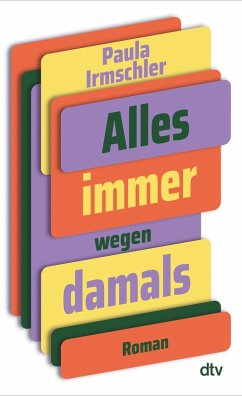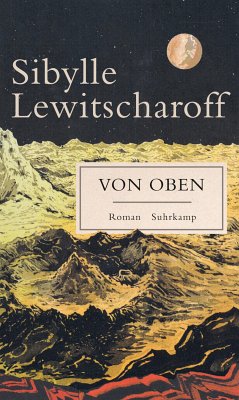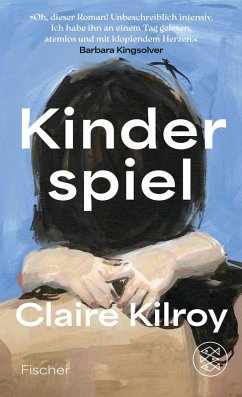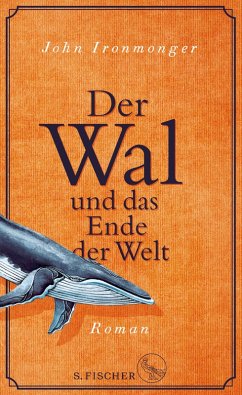Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 Die selbstbewusste Kerze ist gerade noch ein Kind. Sie lebt in einem kleinen, von Wald und Feldern umgebenen Dorf, das nur noch wenige Bewohner hat. Doch Kerze verteidigt ihr Dorf gegen den Schwund, sie ist hier fest verwurzelt. Eines Tages geht Power verloren, der Hund einer Nachbarin. Die Hitschke ist verzweifelt - seit ihr Mann nicht mehr da ist, lebt sie allein. Kerze macht sich auf die Suche nach Power und verspricht, den Hund zurückzubringen. Koste es, was es wolle. Denn Kerze hält, was sie verspricht. Immer! Sie geht methodisch vor...
Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 Die selbstbewusste Kerze ist gerade noch ein Kind. Sie lebt in einem kleinen, von Wald und Feldern umgebenen Dorf, das nur noch wenige Bewohner hat. Doch Kerze verteidigt ihr Dorf gegen den Schwund, sie ist hier fest verwurzelt. Eines Tages geht Power verloren, der Hund einer Nachbarin. Die Hitschke ist verzweifelt - seit ihr Mann nicht mehr da ist, lebt sie allein. Kerze macht sich auf die Suche nach Power und verspricht, den Hund zurückzubringen. Koste es, was es wolle. Denn Kerze hält, was sie verspricht. Immer! Sie geht methodisch vor, durchstreift das Dorf und die Felder, tastet sich immer näher an Power heran. Beobachtet wird sie dabei von den Kindern des Dorfes, die sich ihr nach und nach anschließen. Ein ganzes Rudel bildet sich, das bellend und auf allen vieren Powers Fährte aufnimmt. Als klar wird, dass sie ihn nur außerhalb der Dorfgemeinschaft finden können, verlassen die Kinder das Dorf und ziehen in den Wald. Mit außergewöhnlicher Sprachmacht, Scharfsinn und mit enormem Einfühlungsvermögen erzählt Verena Güntner davon, was mit einer Gemeinschaft geschieht, die den Kontakt zu ihren Kindern verliert. ¿Power¿ führt hinein in den Schmerz derer, die zurückbleiben, und zeigt mit großer Kraft, was es braucht, um durchzuhalten, weiterzumachen und Sinn zu finden in einer haltlos gewordenen Welt. '¿Power¿ ist eine faszinierende Parabel auf die Gegenwart, absurd, märchenhaft und radikal. Ein großer Gesellschaftsroman über Macht und Niedertracht - und eine Kampfansage: So, wie es ist, kann es nicht weitergehen.' Jan Brandt 'So etwas habe ich noch nie gelesen.' Thomas Schindler, ARD MoMa 'In zarter und sicherer Sprache schichtet Verena Güntner Ebene auf Ebene, demontiert Geschlechterzuschreibungen, hält sich fern vom Klischee. Und zeigt, welchen Erzählsog die Suche nach einem verschwundenen Haustier entwickeln kann.' Jury des Preises der Leipziger Buchmesse '[Kerze] ist der Herr der Fliegen des 21. Jahrhunderts. [...] Möchte man gleich nochmal lesen.' Elmar Krekeler, DIE LITERARISCHE WELT
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 1.91MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
VERENA GÜNTNER, 1978 in Ulm geboren, spielte nach ihrem Schauspielstudium viele Jahre am Theater. Ihr Debüt >Es bringen< erschien 2014. Ihr zweiter Roman >Power< wurde 2020 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und 2021 mit dem Schubart-Literaturförderpreis bedacht. Als Teil des feministischen Literaturkollektivs LIQUID CENTER gab Verena Güntner gemeinsam mit Elisabeth R. Hager und Julia Wolf 2024 den Kollektivroman >Wir kommen< heraus. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.¿
Produktdetails
- Verlag: DuMont Buchverlag GmbH
- Seitenzahl: 250
- Erscheinungstermin: 11. Februar 2020
- Deutsch
- ISBN-13: 9783832184988
- Artikelnr.: 58329767
 buecher-magazin.deEin kleines Dorf ist im Ausnahmezustand. Und alles beginnt mit dem Verschwinden von Power, dem Hund der Frau Hitschke. Ein elfjähriges Mädchen macht sich auf die Suche nach dem vermissten Tier. Tagelang durchstreift sie allein den Wald und ist dabei so beharrlich, dass sich ihr nach und nach immer mehr Kinder anschließen. Mit Ferienbeginn ist es endgültig so weit: Alle Kinder sind weg, verschwunden in den Wald, wo sie auf Hundeweise an einem geheimen Ort miteinander leben. Den Erwachsenen gelingt es partout nicht, sie zu finden. Das Szenario erinnert an Jugendbücher neuerer Prägung, in denen Kinder in einer erwachsenenlosen Welt sich selbst überlassen sind. Doch diese Kinder haben, scheint es, nur auf einen Anlass gewartet, der Welt zu entfliehen. Und die Erwachsenen finden sich in der Rolle der hilflos Zurückgebliebenen; allen voran die arme Hitschke, die nicht nur keinen Hund mehr hat, sondern auch für das Verschwinden der Kinder verantwortlich gemacht wird. Güntners surrealistischer Handlungsentwurf enthielte theoretisch genügend Bedrohungspotenzial für einen rabenschwarzen Katastrophenroman. Das ist „Power“ nicht. Was es aber sonst sein könnte – Gesellschaftssatire, Parabel, Abenteuerroman? –, lässt sich nur sehr schwer sagen. Das ist irritierend und reizvoll zugleich.
buecher-magazin.deEin kleines Dorf ist im Ausnahmezustand. Und alles beginnt mit dem Verschwinden von Power, dem Hund der Frau Hitschke. Ein elfjähriges Mädchen macht sich auf die Suche nach dem vermissten Tier. Tagelang durchstreift sie allein den Wald und ist dabei so beharrlich, dass sich ihr nach und nach immer mehr Kinder anschließen. Mit Ferienbeginn ist es endgültig so weit: Alle Kinder sind weg, verschwunden in den Wald, wo sie auf Hundeweise an einem geheimen Ort miteinander leben. Den Erwachsenen gelingt es partout nicht, sie zu finden. Das Szenario erinnert an Jugendbücher neuerer Prägung, in denen Kinder in einer erwachsenenlosen Welt sich selbst überlassen sind. Doch diese Kinder haben, scheint es, nur auf einen Anlass gewartet, der Welt zu entfliehen. Und die Erwachsenen finden sich in der Rolle der hilflos Zurückgebliebenen; allen voran die arme Hitschke, die nicht nur keinen Hund mehr hat, sondern auch für das Verschwinden der Kinder verantwortlich gemacht wird. Güntners surrealistischer Handlungsentwurf enthielte theoretisch genügend Bedrohungspotenzial für einen rabenschwarzen Katastrophenroman. Das ist „Power“ nicht. Was es aber sonst sein könnte – Gesellschaftssatire, Parabel, Abenteuerroman? –, lässt sich nur sehr schwer sagen. Das ist irritierend und reizvoll zugleich.© BÜCHERmagazin, Katharina Granzin (kgr)
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensent Hubert Winkels sieht das "Ende der Parabel" gekommen mit diesem Roman von Verena Güntner. Wenn ihm die Autorin von dem Mädchen Kerze erzählt, die alle Kinder des Dorfes versammelt, um Hund Power imWald zu suchen, wobei die Kinder zunehmend selbst zum Rudel werden -inklusive toben, beißen und am Anus der anderen riechen - weiß Winkels nicht recht, ob er eine moderne Variante des "Herrn der Fliegen", eine"dystopische Umkehrung" von "Emil und die Detektive" oder einen Romanüber einen "Freiheitsakt mit antizivilisatorischen Motiven" liest. Stört den Rezensenten aber auch nicht weiter: Wenn keine Interpretationsmöglichkeiten bleiben, bleibt dennoch: "gute Literatur",schließt er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Gebundenes Buch
Allegorie auf das Verschwinden
In ihrem zweiten Roman mit dem irreführenden Titel «Power» thematisiert die Schriftstellerin Verena Güntner nichts, was irgendwie mit ‹Kraft› assoziiert werden könnte, sondern das Verschwinden und seine gesellschaftlichen …
Mehr
Allegorie auf das Verschwinden
In ihrem zweiten Roman mit dem irreführenden Titel «Power» thematisiert die Schriftstellerin Verena Güntner nichts, was irgendwie mit ‹Kraft› assoziiert werden könnte, sondern das Verschwinden und seine gesellschaftlichen Vorbedingungen. Der soeben erschienene Band ist für den diesjährigen Leipziger Buchpreis nominiert, wobei die Jury ihre Wahl folgendermaßen begründet: «In zarter und sicherer Sprache schichtet Verena Güntner Ebene auf Ebene, demontiert Geschlechter-Zuschreibungen, hält sich fern vom Klischee. Und zeigt, welchen Erzählsog die Suche nach einem verschwundenen Haustier entwickeln kann.»
Nach einem irritierenden, unverständlichen Prolog, der den Schluss des zweiteiligen Romans zumindest atmosphärisch vorwegnimmt, glaubt man sich anfangs in einer Pippi-Langstrumpf-artigen Geschichte. Deren nicht minder vorlaute, selbstbewusste, elfjährige Heldin hört auf den schönen Namen ‹Kerze› als Symbol des Lichts, welches sie ins Dunkle bringt. Weniger symbolisch trägt der verschwundene Hund ihrer Nachbarin, der alten Hitschke, den Namen ‹Power›, ein eher profaner Einfall seines Frauchens. Als die nämlich überraschend nach dem Namen des noch ungetauften Welpen gefragt wurde, fiel ihr Blick zufällig auf eine Kaffeemaschine, deren Einschalttaste so beschriftet war. Dieser inzwischen ebenfalls elfjährige Hund ist eines Tages verschwunden, und Kerze verspricht der untröstlichen Alten, ihn zu finden. Was folgt ist eine intensive Suchaktion des Mädchens im angrenzenden Wald, der sich, die großen Ferien haben gerade begonnen, nacheinander auch sämtliche Kinder des 200-Seelen-Dorfes anschließen. Was wie ein kindliches Abenteuerspiel beginnt, nimmt schon bald geradezu kafkaeske Züge an: Die Kinder kommen nicht mehr nach Hause, bleiben wochenlang im Wald, bewegen sich auf allen Vieren, beginnen zu bellen, ja sie basteln sich sogar einen Schwanz, den sie sich umbinden und mit dem sie wedeln, wie ein Hunderudel hausen sie zusammen in einem tiefen Bombentrichter im Wald. Die alte Hitschke kocht ihnen aus Dankbarkeit täglich ein Essen, das sie in aller Herrgottsfrühe heimlich am Waldrand abstellt. Kein Erwachsener darf sich ihnen nähern, sämtliche Rückhol-Aktionen ihrer genervten Eltern scheitern kläglich, die Kinder weichen ihnen geschickt aus und bleiben unauffindbar.
Um den eher banalen Kern dieser chronologisch erzählten Geschichte herum entwickelt sich in parallelen Handlungssträngen, durch Rückblenden angereichert, ein nachdenklich machendes Szenarium der Radikalisierung, als deren Ursache sich die erschreckende Kontaktarmut erweist. Das Leitmotiv des spurlosen Verschwindens wiederholt sich auch bei den Menschen, der Mann der alten Hitschke war eines Tages ebenso plötzlich nicht mehr da wie die Frau des Huberbauern von nebenan, beide Male ausgelöst durch ein geradezu abnormes Fehlen jedweder emotionaler Bindung, das sich in gleicher Weise dann auch auf den Sohn des Bauern erstreckt. Und auch die alte Frau verlässt klammheimlich für immer ihr Haus und das Dorf, dessen Bewohner «Hitschke-raus» skandieren und sie mit Wandschmierereien zunehmend terrorisieren, weil sie mit ihrem verschwundenen Hund letztendlich für das unerklärliche Verhalten der Kinder verantwortlich sei. Insoweit ist der Roman eine exemplarische Studie der grassierenden gesellschaftlichen Verrohung, hochaktuell also!
Sprachlich uninspiriert, zuweilen etwas holprig - wenn beispielsweise von «hektarlangen» Getreidefeldern die Rede ist - entwickelt Verena Güntner ihre verstörende Geschichte eines kindlich naiven Ausbruchs aus dem profanen Alltag als Allegorie auf das nur äußerlich wohlgeordnete soziale Gefüge einer eng benachbarten Dorfgemeinschaft. Die dabei entstehende Gruppendynamik ist psychologisch nachvollziehbar und anschaulich dargestellt, der Plot mündet allerdings, nachdem das Ganze völlig aus dem Ruder gelaufen ist, abrupt in ein leider allzu voraussehbares Ende, das dann doch wieder an Bullerbü erinnert.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der Roman „Power“ von Verena Güntner handelt von einem Hund, der verschwunden ist. In dem Dorf, in dem das geschehen ist und das an einem Waldrand liegt, ist darüber zunächst nur seine Besitzerin betrübt. Doch das Buch macht seinem Namen alle Ehre, denn …
Mehr
Der Roman „Power“ von Verena Güntner handelt von einem Hund, der verschwunden ist. In dem Dorf, in dem das geschehen ist und das an einem Waldrand liegt, ist darüber zunächst nur seine Besitzerin betrübt. Doch das Buch macht seinem Namen alle Ehre, denn „Power“ bildet die treibende Kraft, die die Kinder des Orts schließlich geschlossen dazu bringt, ihn auf eine ungewöhnliche Weise zu suchen.
Kerze, die Protagonistin des Romans, ist elf Jahre alt und damit genauso alt wie Power. Sie lebt allein mit ihrer Mutter, die tagsüber zur Arbeit ist. Ihren gegebenen Versprechen kommt sie immer nach. Sie hat sich ihren Spitznamen gegeben, weil sie Verzweifelten, Enttäuschten und Bedrückten wieder Licht und damit Freude zurück in den Alltag bringen will. Dem Auftrag der älteren Dorfbewohnerin Frau Hitschke, nach ihrem Hund Power zu suchen, kommt sie daher gerne nach. Sie ist selbstbewusst, vorlaut und lebt ihre Rolle als Detektivin streng und übertrieben aus.
Das Ende der Geschichte ist nicht verwunderlich, denn das Ergebnis der Suche wird auf den ersten Seiten vorweggenommen. Dennoch ist die Erzählung bis dahin überraschend. In einem kleinen Ort, in dem jeder jeden kennt mit all seinen Eigenarten, Allüren, Freundschaftsbeziehungen und Abneigungen stehen die Sommerferien an. Für Kerze und die übrigen Kinder ist das eine eher langweilige Zeit. Keiner hat eine Urlaubsreise, der Tag liegt wie ein dunkles Loch vor einem, denn Aktionen in Form von Ferienspielen oder ähnlichen bieten sich hier keine an. Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit auf dem Dorf. Kerze aber bietet mit ihrer Suche eine prima Ablenkung vom Ferienalltagseinerlei. Ganz nebenher tut man auch noch Gutes, wenn man sich der Sache anschließt und einer Ortsbewohnerin vielleicht sogar ihren kleinen Liebling wiederbringen kann. So beginnt es.
Zunehmend übernimmt Kerze die Organisation der Gruppe der Kinder, von denen sich immer mehr der Suche anschließen, und gewinnt dadurch deren Vertrauen. Die Gruppe folgt ihren Anweisungen, aber mit steigender Verantwortung für die Entscheidung über Gerechtigkeit und die Übernahme von Schiedssprüchen ändert sich allmählich ihr Ton. Die Suche wird immer verbissener. Die Ideen von Kerze zum Auffinden des Hunds werden immer abstruser, aber keines der Kinder wagt gegen die Methoden aufzubegehren, der Druck der Gruppe auf Uniformität wächst.
Die Eltern sehen dem Treiben unterdessen tatenlos zu. In der von der Autorin aufgezeigten Welt, in der Erwachsene ihrer Rolle als Vermittler von Werten und Normen kaum nachkommen, testen die Kinder ihre Grenzen bis zum Äußersten aus und die Mütter und Väter rühmen sich ihrer erzieherischen Fähigkeiten und lehnen jede Hilfe ab, die nicht aus diesem Kosmos kommt.
Auf überspitzte Weise zeichnet Verena Güntner in ihrem Roman „Power“ die ungewöhnliche Art eines Zusammenschlusses von Kindern, zunächst mit einem erkennbar guten Sinn, später aber immer mehr aus dem Ruder laufend. Ihre Sprache ist beredt, klar und mit viel feinem Gespür fürs Detail. Die Geschichte regt zum Nachdenken an. Gerne vergebe ich hierzu eine Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Das Werk "Power" von Verena Günter ist als gebundene Ausgabe und Softcover, sowie Ebook und Hörbuch über Dumont Verlag erschienen. Das Buch umfasst 254 Seiten.
Kerze ist noch ein Kind, aber sehr selbstbewusst und sie hilft wo sie nur kann. Als der Hund „Power“ …
Mehr
Das Werk "Power" von Verena Günter ist als gebundene Ausgabe und Softcover, sowie Ebook und Hörbuch über Dumont Verlag erschienen. Das Buch umfasst 254 Seiten.
Kerze ist noch ein Kind, aber sehr selbstbewusst und sie hilft wo sie nur kann. Als der Hund „Power“ verschwindet verspricht sie ihn zurück zu bringen ob Tod oder lebendig. Doch nicht nur sie, sondern alle Kinder sind schon bald in den Wald gezogen und suchen dort nach dem Hund.
Die Geschichte regt schon zum Nachdenken an und hat eine bittere, bleierne Schwere und Hoffnungslosigkeit, die einen nieder reißt, aber die Handlung ist sehr lebensfremd und absurd. Und je mehr man versucht sich darauf einzulassen, desto verworrener wird es. Der Sprachausdruck und die Fantasie sind zweifelsohne literarisch ausgereift. Schade das die Geschichte an sich so Realitätsfremd bleibt.
Fazit: Fantastische, realitätsfremde Geschichte, die eine bleierne Schwere und Hoffnungslosigkeit erzeugt und zur inneren Verwirrung führt. Literarisch großartiger Ausdruck mit absurden Handlungen. Kann man Zwischendurch lesen!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Sprache hat Sogwirkung. Verena Güntner baut ein faszinierendes Figurengeflecht auf. Dennoch ließ mich „Power“ etwas ratlos zurück.
Vieles von dem, was ich an „Power“ mochte, lag an den kleinen überraschenden Wendungen in der Geschichte, die in …
Mehr
Die Sprache hat Sogwirkung. Verena Güntner baut ein faszinierendes Figurengeflecht auf. Dennoch ließ mich „Power“ etwas ratlos zurück.
Vieles von dem, was ich an „Power“ mochte, lag an den kleinen überraschenden Wendungen in der Geschichte, die in vieler Hinsicht immer radikaler wurde. Daher möchte ich nicht so konkret auf den Inhalt eingehen. Aber Power ist der Hund, der verschwindet, und vom Mädchen Kerze und den anderen Kindern des Dorfes gesucht wird.
Sehr gut gefallen hat mir die Betrachtung, dass Kinder viel mehr Macht haben, als wir ihnen gemeinhin zugestehen. Das ist gerade in Hinblick auf die „Fridays for Future“-Bewegung ein hoffnungsfroher Gedanken. Die Kinder in „Power“ schwanken daher zwischen zwei Phänomenen: Zum einen sind die Kinder mit dem Phänomen des Adultismus konfrontiert, der Diskriminierung aufgrund ihres jungen Lebensalters. Dass sie nicht ernst genommen werden, allein aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder sind. Und dadurch, dass sie nicht ernst genommen werden, kommt eine Dynamik in Gange, die sich später nicht mehr stoppen lässt. Zum anderen geht es um die sogenannte Parentifizierung, da werden die Rollen von Kindern und Erwachsenen umgekehrt, was für die Kinder eine individuelle wie strukturelle Überforderung bedeutet.Adultisms und Parentifizierung, wird bei Güntner klar, sind Antithesen, die vollends parallel existieren können. Und beide lasten den Kindern und Jugendlichen etwas auf, was ihre freie Entfaltung behindert.
Wenn es um die Kinder im Wald geht, liegt die Geschichte irgendwo zwischen „Herr der Fliegen“ und der Rattenfänger von Hameln, und der Name des Hundes ist hier durchaus programmatisch zu sehen, es geht eben auch um Macht: Wer bestimmt, wann Ende ist? Wer ist der Leitwolf? Dass es mit Kerze eine HerrIN ist, eine RattenfängerIN, eine LeitwölfIN, dieser Gender Twist hat mir sehr gut gefallen. Von der feinen Beobachtung der Sozialstruktur hat mich „Power“ an „Unter Leuten“ von Juli Zeh erinnert.
Die Ursachen der ganzen Misere haben viel mit toxischer Männlichkeit und Gewalt (gegen Kinder, Erwachsene und Tiere) zu tun. Die Missetaten der Väter (oder Nicht-Väter) suchen letztendlich die Kinder heim. Das zu lesen ist zermürbend und schmerzhaft, und ich möchte dies explizit auch als Content Note / CN benennen. Gerade, weil sich diese Themen im Verlauf des Buches einschleichen und nicht von Anfang an klar ersichtlich sind, auch, wenn es absehbar ist.
„Power“ bildet diese Kausalitäten nach und auch, wenn ich beim Lesen einige erahnen konnte, so gefiel mir doch Güntners Spurensuche. Der Verlauf von Hitschkes Geschichte hat mir nicht nur einmal die Atemluft abgeschnürt.
Gestolpert bin ich, immer wieder über die Grundkonstruktion. Warum wehren sich die Eltern nicht „normal“ und holen die Behörden zu Hilfe? Wie können sie in dieser quasi feudalen Blase leben? Manches ist mir zu simplifiziert, wie die Geschichte von dem Jungen Henni, dem einzigen Nazi im Dorf.
Wenn ich das weiterdenke, liegt darin eine noch größere Unentschlossenheit: Ist Kerzes Kindergruppe im Wald nun ein Dystopie oder eine Utopie? Diktatur oder Befreiung? Zwang oder Freiheit? Schon das Bild des Rudels lässt in mir immer ein faschistoides Bild entstehen. Ja, ich weiß, ich soll mich all dieses Fragen, aber wenn ich dann das Ende betrachte, bleibt mir das Fragezeichen zu unentschlossen. Aber vielleicht fehlt mir einfach auch nur der Code, dass ich diesen Roman dechiffrieren könnte.
Fazit
„Powers“ Nominierung beim Preis der Leipziger Buchmesse finde ich gerechtfertigt, denn die Autorin traut sich etwas. Meine Ratlosigkeit ist aber auch eine Woche nach meinem Lektüreende noch vorhanden, das ist zwar sicherlich gewollt, hinterlässt aber ein unbefriedigendes Gefühl. Daher vergebe ich 4 von 5 Sternen und eine Empfehlung für alle, die sich auf ein ungewöhnliches Buch einlassen möchten. Aber bitte beachtet, dass es keine leichte Lektüre ist, die durchaus Menschen mit Gewalterfahrung triggern kann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für