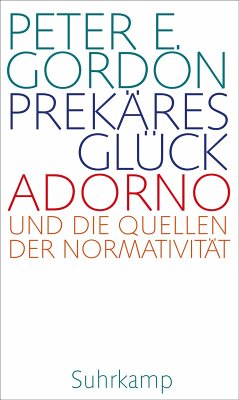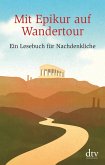Mehr als fünfzig Jahre nach seinem Tod ist immer noch höchst umstritten, worin das Vermächtnis Theodor W. Adornos besteht. Viele sehen in ihm den Philosophen der kompromisslosen Negativität, der gnostischen Finsternis, auch der allumfassenden, maßstabslosen Kritik. Selbst in der breiteren Öffentlichkeit hat sich das Bild vom Denker der totalisierenden Verzweiflung, des »Es gibt kein richtiges Leben im falschen« verfestigt - bis zum Klischee.
Der Historiker und Philosoph Peter E. Gordon stellt dieses Bild entschieden in Frage. Adorno, so argumentiert er, ist vielmehr als ein Theoretiker zu verstehen, dessen Praxis der Kritik sich an einer unrealisierten Norm des menschlichen Gedeihens orientiert - des prekären Glücks in einer radikal unvollkommenen Welt. Diese Norm weist Gordon als das einigende Thema aus, das Adornos gesamtes Werk durchzieht, seine soziologischen Schriften ebenso wie seine Moralphilosophie, Metaphysik und Ästhetik. Prekäres Glück ist selbst ein Glücksfall: eine faszinierende Interpretation von Adornos Vermächtnis, das nun in einem völlig neuen Licht erscheint und als unverzichtbare Ressource für die kritische Theorie von heute.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Peter Gordon spürt den Gegenmomenten zum negativen Ganzen bei Theodor W. Adorno nach
Auch schwermütigen Sentenzen wachsen manchmal Flügel. Aus Theodor W. Adornos Denkbilder-Buch "Minima Moralia" ist ein Sinnspruch entflogen, der einiges dazu beigetragen haben dürfte, dass sein Autor zuzeiten im Ruf eines Unheilspropheten stand: "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." Sogar die Gedenktafel, die an Adornos Frankfurter Wohnstätte im Westend angebracht ist, ist versehen mit dem Diktum - und erweckt, quasi halbamtlich, den Eindruck, als resümiere sich darin die denkerische Quintessenz des Philosophen. Peter E. Gordon hat ein aufklärendes Buch geschrieben, dessen Hauptaufgabe es erklärtermaßen ist, das Bild von Adorno als Schwarzmaler, das sich auf den Flügeln nicht nur jenes Zitats verbreitet hat, zu korrigieren. Es ist aus den Frankfurter Adorno-Vorlesungen hervorgegangen, die der in Harvard lehrende Ideenhistoriker und Philosoph im Jahr 2019 gehalten hat.
Das leicht von der Zunge gehende Bonmot, das verrät bereits das Denkstück, dem es entstammt, ist nicht Adornos Antwort auf die Frage nach der "Normativität", nach der möglichen Richtschnur für ein richtiges Leben. Es beschließt vielmehr eine mehrseitige Reflexion über Wohnen und Privateigentum und gibt von zwei gegenläufigen Ansichten, die Adorno pointiert nachzeichnet, sich aber nicht als solche zu eigen macht, die eine wieder - eine Art Ausrede. Das mag hier auf sich beruhen, zumal Gordon diesen Kontext gar nicht einblendet. Aber selbst wenn das Diktum "programmatisch" zu verstehen wäre, gäbe es keine eindeutige Antwort. "Es gibt kein richtiges Leben im falschen" ähnelte dann eher einem Orakelspruch, der so oder anders ausgedeutet werden könnte. Legt er Resignation und Passivität nahe, eine quietistische Lebenshaltung? Oder stellt er einen nihilistischen Freibrief aus für enthemmten Aktivismus, für ein gewissenloses Leben jenseits von Richtig und Falsch?
Zudem ruft die Behauptung von der Unmöglichkeit eines Richtigen im Falschen eine erkenntnispraktische Frage auf den Plan: Wie ließe sich überhaupt wissen und sodann beklagen, dass "das Leben" - lies: das menschliche Zusammenleben - "falsch" ist? Wäre dann, wenn es sich so verhielte, nicht der "Verblendungszusammenhang", von dem Adorno ebenfalls spricht, ein "totaler"? Wäre nicht jede Lebensäußerung, einschließlich der Äußerung der fraglichen Behauptung, notwendig falsch? Und wenn Letztere gleichwohl Richtigkeit beanspruchte: Woher käme der Maßstab der Kritik? Von "außerhalb"? Ein anderer herumgeisternder Aphorismus der "Minima Moralia" verkündet ja tatsächlich und lapidar: "Das Ganze ist das Unwahre." Leben wir in einer geschlossenen Anstalt, aus der es kein Entkommen gibt?
Solche und verwandte Probleme lernt jeder Adorno-Leser kennen, und sie stellen jede systematische Adorno-Interpretation auf die Probe. Ein Hinweis, wie der hermeneutischen Herausforderung begegnet werden könnte, findet sich bereits auf der ersten Seite der "Reflexionen aus dem beschädigten Leben" (wie der Untertitel der 1951 erstmals gedruckten moralphilosophischen Essay- und Aphorismensammlung lautet). Die "Wahrheit" über das Leben könne heute nur noch erfahren, liest man dort, wer "dessen entfremdeter Gestalt" nachforsche. Eingehender erläutert Adorno, worauf er zielt, in einer 1963 gehaltenen Vorlesung über Probleme der Moralphilosophie: "Wir mögen nicht wissen, was das absolut Gute, was die absolute Norm, ja auch nur, was der Mensch oder das Menschliche und die Humanität sei, aber was das Unmenschliche ist, das wissen wir sehr genau. Und ich würde sagen, dass der Ort der Moralphilosophie heute mehr in der konkreten Denunziation des Unmenschlichen als in der unverbindlichen und abstrakten Situierung etwa des Seins des Menschen zu suchen ist."
Eine geschichtsphilosophische Epochendiagnose geht mit einer erkenntnispraktischen Maxime einher: Wir wissen nicht mehr, wer wir als Menschen sind und was wir als Menschen zu sein haben, wir wissen nicht, was wir sollen - aber wir wissen, was nicht sein soll. Und an diesem Nicht-sein-Sollenden, am Unmenschlichen, das es zu "denunzieren" gelte, findet die moralphilosophische Kritik eine erste Orientierung in orientierungsloser Zeit. Man kann diesen Grundgedanken "negativistisch" nennen, wie Michael Theunissen es getan hat, von dem Gordon sich anregen lässt. Theunissen kennzeichnet mit dem Etikett "Negativismus" einen eigenen Typus von Philosophie, der um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts aufkommt, als Reaktion auf Orientierungskrisen, die der geschichtliche Aufbruch in die Moderne mit sich bringt.
Adorno verschrieb sich keinem "totalen" Negativismus. Ein solcher käme einem Nihilismus gleich, dem Nihilismus im vulgären Sinn, der die Sinnlosigkeit von allem konstatieren zu können glaubt und vor dem "Negativen der bestehenden Welt" (so die berühmte zeitdiagnostische Wendung des jungen Hegel) kapituliert. Die Differenz markiert aufs Schönste, in beinahe poetischem Gewand, ein Satz aus Adornos "Negativer Dialektik": "Bewusstsein könnte gar nicht über das Grau verzweifeln, hegte es nicht den Begriff von einer verschiedenen Farbe, deren versprengte Spur im negativen Ganzen nicht fehlt."
Gordon, könnte man sagen, sichert sorgfältig die Spuren, die jene vom Grau "verschiedene Farbe" in Adornos Werk, in Metaphysik und Ästhetik, in der Sozial- und Moralphilosophie, hinterlassen hat. Die Spuren führen ihn, einen kundigen und subtilen Leser, auf weitläufigem Parcours zu Adornos "Quellen der Normativität". Der Titel "Prekäres Glück" deutet auf das Gesuchte voraus. Es sind demnach nicht zuerst Begriffe, die den Ursprungsort von so etwas wie Normativität bilden, es sind elementare Erfahrungen, solche des Leids und solche des Glücks; eines Glücks, das sich laut Adorno an "aufgehobenem Leid" entfaltet, das sich aber auch in unreglementiertem Erleben einstellen kann, etwa in kindlichen Spielen, die er einmal als "bewusstlose Übungen zum richtigen Leben" charakterisiert, oder in Situationen erfüllenden ästhetischen Empfindens.
Die Norm, die durch entsprechende Erfahrungen innerviert ist und die Gordon als Maßstab der "Kritikpraxis" Adornos nachzuzeichnen versucht, weist über das Neinsagen zum Unmenschlichen hinaus. Der Autor nennt sie die Idee "menschlichen Gedeihens" - eine naturgemäß nicht ganz unbekannte Idee, die zumindest an die Idee eines gelingenden, glückenden oder guten Lebens anklingt. Inmitten des "falschen Zustands" sei dies "andere" Leben unrealisiert und unrealisierbar, aber eben gleichwohl in Momenten intensiver Erfahrung antizipierbar. Mögen wir auch nicht mehr wissen, was "der Mensch" sei, so sieht Gordon in Adornos Schriften doch das "Porträt einer moralisch responsiven Persönlichkeit" Kontur annehmen, die ebenso offen wie verletzlich sei - ein emphatisches Gegenbild zu einem vom "falschen Leben" beschädigten Charakter. Das Fazit: Adorno habe mehr zu bieten als "die negative Ethik eines weniger falschen Lebens".
Mit einem Mangel allerdings sind die Quellen, aus denen Adorno geschöpft haben mag, in den Augen Gordons behaftet. Es seien lediglich Quellen - und keine Begründungen von Normen, die philosophischen Rationalitätsstandards genügen könnten. Adorno tue mitunter so, als würden unmittelbare Erfahrungen prekären Glücks oder auch verzweifelten Leids "sich selbst beglaubigen", als enthielten sie in sich selbst bereits eine ethische Richtschnur oder unwidersprechliche moralische Wahrheit, die sich nicht mehr argumentativ ausweisen müsse. Diese Annahme laufe womöglich auf einen Mythos hinaus, auf den "Mythos des normativ Gegebenen". Darum erwägt Gordon zum Schluss, Adorno unter die Arme zu greifen und dessen moralische Phänomenologie durch eine Theorie intersubjektiver Rechtfertigung von Normen zu ergänzen - durch das also, was die jüngere Frankfurter Schule von Jürgen Habermas bis Axel Honneth und Rainer Forst in die Waagschale der Geistesgeschichte geworfen hat. Ob Adorno damit einverstanden wäre, lässt sein Interpret klüglich offen. UWE JUSTUS WENZEL
Peter E. Gordon: "Prekäres Glück". Adorno und die Quellen der Normativität.
Aus dem Englischen von Frank Lachmann. Suhrkamp Verlag, Berlin 2023.
470 S., geb., 38,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main