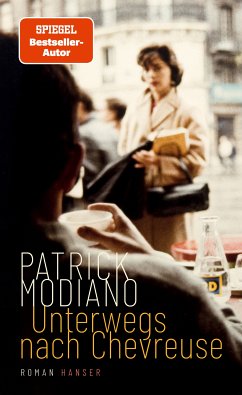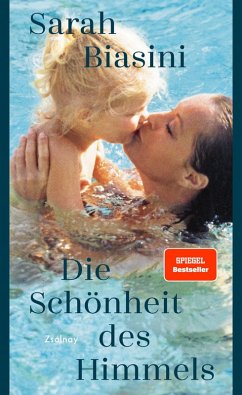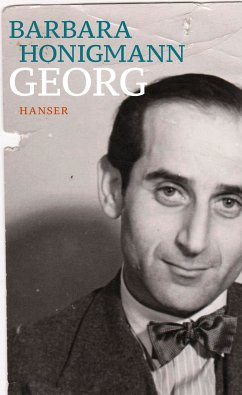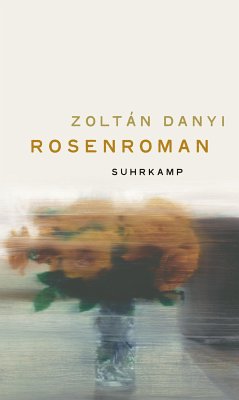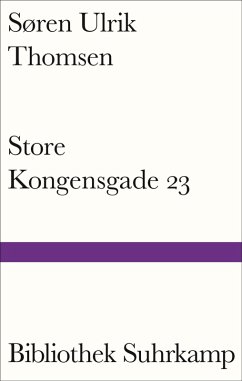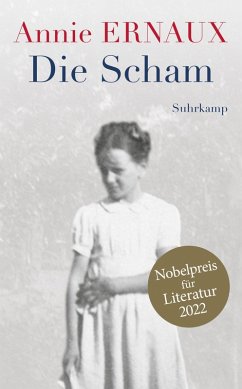Quallen haben keine Ohren (eBook, ePUB)
Roman Ein kraftvoll poetischer Tauchgang in die Welt der Gehörlosen
Übersetzer: Denis, Nicola
Sofort per Download lieferbar
Statt: 23,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In ihr rechtes Ohr dringen noch ein paar Töne, links herrscht Stille. Seit ihrer Kindheit befindet Louise sich in einer Zwischenwelt. Im Hellen kann Louise die Lippen der Menschen lesen. Wird es dunkler oder sind Gesichter abgewandt, driftet sie ab in einen Zustand zwischen Imagination und Realität, in einen Raum der unendlichen Möglichkeiten. Dann beginnt sie, die Hörlücken mit ihrer Fantasie zu füllen, die bevölkert ist von drei fiktiven Figuren: einem Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, einem Hund namens Zirrus sowie einer launischen Botanikerin, die Louise während der langen Monate ...
In ihr rechtes Ohr dringen noch ein paar Töne, links herrscht Stille. Seit ihrer Kindheit befindet Louise sich in einer Zwischenwelt. Im Hellen kann Louise die Lippen der Menschen lesen. Wird es dunkler oder sind Gesichter abgewandt, driftet sie ab in einen Zustand zwischen Imagination und Realität, in einen Raum der unendlichen Möglichkeiten. Dann beginnt sie, die Hörlücken mit ihrer Fantasie zu füllen, die bevölkert ist von drei fiktiven Figuren: einem Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, einem Hund namens Zirrus sowie einer launischen Botanikerin, die Louise während der langen Monate des Nachdenkens und Zweifelns begleiten. Denn Louise steht vor einem radikalen Schritt: Ihr Gehör schwindet nach und nach, und die Ärzte raten ihr, ihr verbleibendes natürliches Gehör durch ein Cochlea-Implantat zu ersetzen. Um sich der Entscheidung zu entziehen, flüchtet sich Louise immer mehr in ihre Traumwelt, die ständig mit den großen Veränderungen in ihrem Leben kollidiert - einer beginnenden Liebesbeziehung, dem ersten Job bei der Stadtverwaltung, einer zerbrechenden Freundschaft. Doch die Zeit drängt, und Louise muss ihre Entscheidung treffen.
Quallen haben keine Ohren taucht mit kraftvoll poetischen und überraschenden Bildern ein in die Welt der Gehörlosen. Eine junge, hörbeeinträchtigte Pariserin hat sich den Fallstricken der Sprache zu stellen und erlebt die Unzulänglichkeit von Licht und Schatten. Und zugleich zeigt sich gerade in diesem Schwebezustand die Kraft der Imagination.
Quallen haben keine Ohren taucht mit kraftvoll poetischen und überraschenden Bildern ein in die Welt der Gehörlosen. Eine junge, hörbeeinträchtigte Pariserin hat sich den Fallstricken der Sprache zu stellen und erlebt die Unzulänglichkeit von Licht und Schatten. Und zugleich zeigt sich gerade in diesem Schwebezustand die Kraft der Imagination.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.